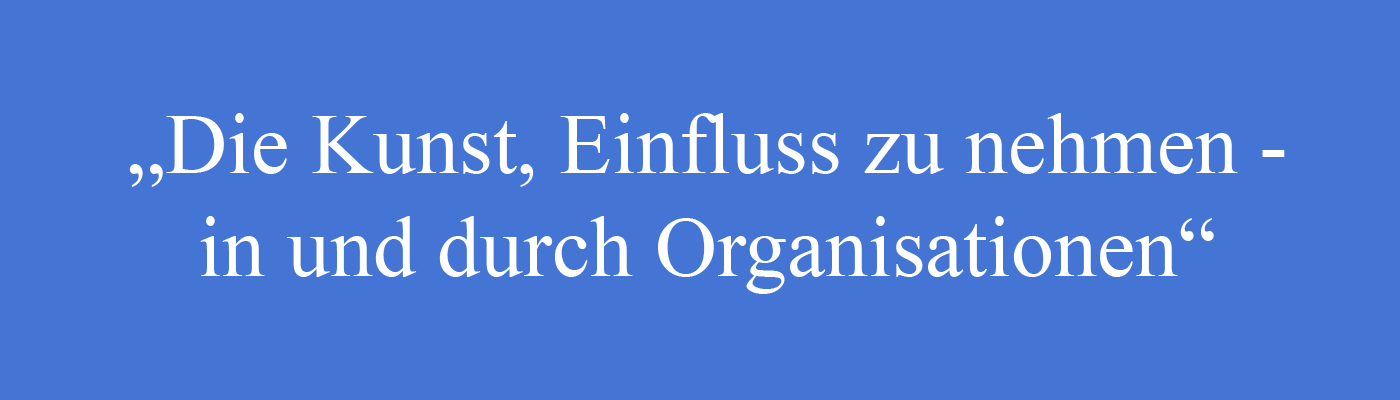Leseprobe
Zu den Inhalten
Kap. 1 Grundlagen der Einflussnahme
Nahezu selbstverständlich beginnt das Buch mit der Klärung der zentralen im Titel verwendeten Begriffe. Einflussnahme wird dabei verstanden als das Bemühen und das Ergebnis wirksam zu sein im sozialen Gefüge und mit der Übertragung des Watzlawick’schen Axioms für Kommunikation in dem Sinne: Man kann nicht nicht Einfluss nehmen. In der verwendeten Definition von Einflussnahme wird auch schon das zugrundeliegende Bedürfnis, wirksam zu sein, angedeutet.
Die zentrale Bedeutung der Kommunikation für die Einflussnahme legt es schon nahe, auch für dieses Phänomen den Eisberg als ein anschauliches Modell heranzuziehen. Der weitaus größte Teil liegt unter dem Wasser, d.h. auf der Beziehungsebene, während der kleinere Anteil – lies: die Sachebene – sichtbar aus dem Wasser ragt. Das heißt, auch die Kunst, Einfluss zu nehmen, hat ihre Basis weit überwiegend auf der Beziehungsebene.
Allerdings ist daraus kein Mechanismus abzuleiten, der bei der Anwendung einer bestimmten Technik eine voraussagbare Wirkung erzeugt. Es handelt sich vielmehr um einen Passungs- bzw. Matching-Prozess, der bei dem Akteur einerseits und dem, der beeinflusst werden soll, andererseits, eine gewisse gegenseitige Verständigungsbereitschaft voraussetzt. Eine solche Passung herzustellen ist eben das, was die z.T. nicht erklärbare Kunst ausmacht, also ein Phänomen darstellt, dem in diesem Buch ebenfalls nachgegangen wird.
Gerade dieses Nicht-Erklärbare macht es erforderlich die ethischen Aspekte der Einflussnahme zu thematisieren und die Formen, Mechanismen und Absichten der Einflussnahme von denen einer Manipulation (in der alltäglich negativen Bedeutung dieses Begriffes) abzugrenzen. Dazu gehört es auch, die Grenzen der Einflussnahme zum Thema zu machen.
In diesem Sinne liegt es in einem nächsten Schritt nahe, das Verhältnis von Macht und Einflussnahme aufzugreifen und zu diskutieren, inwieweit Autorität, Hierarchie, Herrschaft oder sogar Gewalt die Möglichkeiten der Einflussnahme verstärken oder überraschenderweise sogar behindern.
Wenn wir – im wahrsten Sinn des Wortes – davon ausgehen, dass Einfluss vor allem dann ausgeübt werden kann, wenn schon etwas fließt, wenn wir von der physikalischen Gesetzlichkeit ausgehen, dass Gleitreibung geringer ist als Haftreibung, kommen wir geradezu zwangsläufig zu dem Schluss, dass es vor allem die Bewegung ist, die eine Einflussnahme ermöglicht oder zumindest erleichtert. Insofern ist es für den Akteur unabdingbar, externe Bewegungen aufzuspüren und sie danach zu beurteilen, welche Möglichkeiten der Einflussnahme darin enthalten sind. Sind keine zu entdecken, können Bewegungen auch selbst angestoßen werden, um eigene Gestaltungsvorstellungen einfließen zu lassen.
In den nachfolgenden Kapiteln geht es dann darum, die Bewegungen nach Anlässen und den sich daraus ableitenden Aufgaben für einen Akteur zu strukturieren. Daraus können dann Einflusschancen abgeleitet werden. Durch eigene Erfahrungen in vergleichbaren Situationen, d.h. bei den identifizierten unterschiedlichen Anlässen und Akteursrollen, sollen Strukturen, ermittelbare Einflusschancen und daraus abzuleitende Verhaltensstrategien verdeutlicht werden.
In dem Bemühen, zuvor Grundlagen der Einflussnahme aufzuzeigen, konnte ich der Versuchung nicht widerstehen, Möglichkeiten aufzuzeigen, das Phänomen der Einflussnahme zu klassifizieren. Dazu gehört vor allem die Skizze einer Taxonomie der Einflussnahme, die die „Tiefe“ des Einflusses, angefangen von der Aufmerksamkeit für eine Person bzw. deren Meinung, bis hin zur bedingungslosen Gefolgschaft, abzubilden vermag. Damit ist ein Ansatz aufgezeigt, der durchaus weiterhin verfolgt werden sollte. Er muss insofern weiterverfolgt werden, weil er vielleicht einen Prozess deutlich machen kann, wie es zu einer solchen bedingungslosen Gefolgschaft kommen kann, die das Leben in einer aufgeklärten Gesellschaft, bei der Argumente zählen, in höchste Gefahr bringt und uns ins Mittelalter zurückzuwerfen droht.
Kap.2 Einflussnahme als Prozess
Schon die Taxonomie des Einflusses, also die Unterscheidung in unterschiedliche Tiefenstufen, deutet an, dass die Einflussnahme einen Prozess darstellt. In dem Buch gerät dabei vor allem der Anfang dieses Prozesses in den Blickpunkt. Insofern wird dem (ersten) Eindruck als Setzling von Einfluss besondere Aufmerksamkeit zuteil. Er wird beispielhaft bis in einzelne Verhaltensweisen hin betrachtet und das Ergebnis kann durchaus als Quelle für konkrete Ratschläge genutzt werden, zumal es auch biographisch Erlebtes verarbeitet und dadurch seine Aussagekraft durch nachvollziehbare, bebilderte Beispiele verstärkt.
Kap. 3 Anlässe und Akteurs Aufgaben für eine Einflussnahme
Ein Akteur, der Einfluss ausübt, handelt, wie schon in dem Kapitel Grundlagen dargestellt nicht in einem luftleeren Raum, sondern in einem sozialen Umfeld. Die Wirksamkeit seines Handelns ist zu einem großen Teil davon abhängig, wie es ihm gelingt, die Bedingungen eben dieses sozialen Umfeldes mit zu berücksichtigen. Man braucht sich nicht in Spekulationen darüber verlieren, in welchem Umfang wir von Zufällen oder von äußerem Geschehen abhängig sind und wieviel von unserer Gegenwart und Zukunft in unserer eigenen Hand liegen. Entscheidend ist, dass wir das, was uns „passiert“ nicht einfach so hinnehmen, sondern nach Möglichkeiten suchen, etwas daraus zu machen, was in unserem Sinne ist.
Aus der Bewegung selbst, d.h. konkret aus deren Ursachen und auch Zielen, lassen sich dann auch die Einflussmöglichkeiten ableiten. Diese dienen letztendlich der Existenz der Organisation als ein soziales Gefüge, und deren Erhalt selbst. Notfalls werden auch die Ziele der Organisation neu formuliert, wenn sich die alten als überholt erweisen.
Unterschiedliche Ursachen stellen die Organisationen vor unterschiedliche Aufgaben und definieren für einen potenziellen Akteur unterschiedliche Rollen, die wiederum Quellen für eine Einflussnahme darstellen.
Diese Aufgaben können u.a. unterschieden werden in
- Aufbauen
- Integrieren als besondere Form des Aufbauens
- Retten
- Optimieren
- Veränderungen begleiten i.S. von Changemanagement bzw. Organisationsentwicklung
Je nach den individuellen Stärken können diese Aufgaben mehr oder weniger erfolgreich bewältigt werden, und von diesem Erfolg wiederum hängt es ab, wie stark der Einfluss des Akteurs ausfällt.
Aufbauen erfordert Kreativität im Sinne einer Vorstellungskraft, aus dem wenigen, was vorhanden ist, zu schöpfen und etwas Neues zu schaffen.
Integrieren erfordert zusätzlich die Sensibilität das zu bewahren, was sich aus Sicht der Betroffenen schon bewährt hat und ehemalige Organisationseinheiten so zusammenzufügen, dass es ein neues harmonisches oder wenigstens von allen akzeptiertes Gebilde ergibt, für das sich gemeinsam einzusetzen lohnt. Und in dem das Potenzial zu einem sich entwickelnden neuen Wir-Gefühl besteht.
Retten ist hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten in Organisationen hinein wohl am leichtesten zu bewältigen. Ist eine Organisation bedroht, werden gruppendynamische Mechanismen und Effekte wirksam, die In-Out-Group-Effekte hervorrufen. Schlüpft der Akteur dann in die Rolle des Retters, wird er die anderen Gruppenmitglieder leichter als Gefolgsleute hinter sich bringen, allerdings auch mit der Gefahr als tragischer Held zu enden oder als Verräter gemeuchelt zu werden, vor allem, wenn der erklärte Feind sich als übermächtig herausstellt. Die Wirksamkeit nach innen wächst mit der Gefahr des von außen betriebenen Scheiterns.
Optimieren ist im Vergleich zum Retten besonders schwierig, weil diese Aufgabe meist in Situationen zu erledigen ist, in denen es den Organisationen – lies im Regelfall: den Unternehmen – noch gut geht. Dennoch müssen die Betroffenen für Veränderungen gewonnen werden, was besondere Maßnahmen erfordert, die vor allem der Organisationsentwicklung zuzurechnen sind. Dies trifft vor allem auf Aktivitäten zu, die darauf ausgerichtet sind, Bewegung als Managementaufgabe selbst auszulösen, wenn dies nicht von außen aufgezwungen wird, aber vor allem von der Leitungsebene bzw. der Unternehmensspitze für erforderlich gehalten wird. Sie dienen in erster Linie dazu einer Organisation ein legitimes möglicherweise neues Ziel zu geben, wenn das alte obsolet geworden ist, oder ein Unternehmen auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu halten. Solche Vorhaben treffen häufig auf Hindernisse innerhalb der Organisationen, die vor allem in den Ängsten der betroffenen Mitarbeiter ihren Ursprung haben. Inzwischen hat sich für solche Fälle ein Markt an Beratern entwickelt, die über das Rüstzeug verfügen, solche Prozesse zu unterstützen. Vorsicht ist allerdings geboten, da es zu unterscheiden gilt zwischen unseriösen Heilsverkündern und soliden Moderatoren. Professionell agierende Moderatoren sind vor allem dort erforderlich, wo Konflikte vorhanden sind bzw. sich potenziell abzeichnen. Und Moderieren besteht letztlich in der Kunst (und auch hier gibt es einen Teil von nur schwer Erklärbarem), unterschiedliche Positionen und Meinungen aufzugreifen, sie auf deren Wurzeln im Sinne von Interesse zurückzuführen, wo es möglich ist, einen Ausgleich der Interessen zu schaffen, wo Kompromisse nicht erreichbar sind, Entscheidungen voranzutreiben und das Ganze zu einem gemeinsam getragenen Ziel zu führen.
Unabhängig davon, ob ich selbst Akteur war oder andere beobachten konnte, wie sie in und durch Organisationen in die Gestaltung ihres Umfeldes eingegriffen haben, eine Grunderkenntnis hat sich bei mir eingebrannt.
Entscheidende Voraussetzung, Einfluss nehmen zu können ist die Aktion und zwar nicht die erdachte, sondern die tatsächlich in ein Handeln umgesetzte. Wir kennen alle die vielen „Man – Müsste – Mal – Initiatoren“, deren Aktivität sich darin erschöpft, Idee und Ziele zu ersinnen und sich damit begnügen, abzuwarten, bis „man“ etwas tut. Nach diesem „man“ wird heute noch gesucht. Dabei wird dann die zwangsläufig erfolglose Suche nicht nur beklagt, sondern nach den Verursachern gefahndet, die sich angeblich im Lager der anderen versteckt halten. Entscheidend ist vielmehr, eine Chance zu ergreifen und dies trotz möglicherweise noch offener Fragen. Dabei kann das erforderliche Handeln schlicht und einfach darin bestehen, zum Telefonhörer zu greifen bzw. in heutiger Terminologie das Handy zu bedienen, eine Einladung oder einen Brief zu schreiben, Termine zu vereinbaren, eine Vorlage zu erstellen, etwas zum Abschluss zu bringen oder darauf zu achten, dass eine Entscheidung gefällt wird und gegebenenfalls anderen Mut zum Mitmachen zu vermitteln.
Wie solche Akteursaufgaben bewältigt werden können, wird durch meine persönlichen Erfahrungen in unterschiedlichen Berufsfeldern, alle in leitender bzw. moderierender Funktion, aber auch durch meine außerberuflichen Aktivitäten aufbereitet und konkretisiert.
Welche Anforderungen, aber auch welche damit verbundenen Einflussmöglichkeiten bei einer Aufbauarbeit verbunden sind, wird durch meine Erfahrungen in der Anfangsphase der Institutionalisierung der Erwachsenenbildung, Anfang der 70er Jahre, deutlich. Zum geschäftsführenden Pädagogischen Leiter des Niedersächsischen Landesverbandes der Heimvolkshochschulen (eines Zusammenschlusses von 15 selbstständigen Bildungshäusern mit insgesamt ca. 80 hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeitern) ernannt, konnte ich diese Aufbauphase mitgestalten. Dazu gehörte auch die Umsetzung des neu in Kraft getretenen Erwachsenenbildungsgesetztes in Niedersachsen, die Mitarbeit in überregionalen Gremien der Erwachsenenbildung als auch die Integration der einzelnen Mitgliedseinrichtungen, die in Trägerschaft unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen (Kirchen, Gewerkschaften, berufsständische Verbände) gewissermaßen in Konkurrenz zueinanderstanden. Ziel sollte es sein, zu einem gemeinsamen Selbstverständnis zu finden.
Damit war meine Arbeit eingebettet in die umfassende Neustruktur einer zu institutionalisierenden Erwachsenenbildungslandschaft, die die gesamte Republik umfasste, die die „alten, meist ehrenamtlichen Hasen“ in der bisherigen Erwachsenenbildung zu einem fundamentalen Umdenken zwang und uns nachrückenden Neuen ein noch wenig beackertes Tätigkeitsfeld zur Verfügung stellte. Es war ein nahezu paradiesischer Zugang für uns Berufsanfänger, die in der Nachfolge der 68er sowieso gerade dabei war, die Welt zu verändern.
Erfahrungen mit der Aufgabe des Rettens konnte bzw. musste ich während meines Amtes als Dekan des Fachbereichs Erziehungswissenschaften machen, der Mitte der 80er Jahre massiv in seiner Existenz bedroht war. Besondere Aufmerksamkeit und auch Raum in diesem Buch verdient dabei die Arbeit im politischen Feld, insbesondere die Mobilisierung von Gleichgesinnten.
Die Integrationsarbeit als Einflussquelle konnte ich erstmals bei meiner als neuer, junger geschäftsführender Pädagogischer Leiter des Niedersächsischen Landesverbandes der Heimvolkshochschulen Verbandarbeit kennenlernen, aber auch später leitend und leidend zugleich bei dem Zusammenschluss von zwei bisher selbstständigen und auch unterschiedlichen Fachbereichen der Universität Hannover angehörigen Instituten, und zwar unserem Institut für Erwachsenenbildung und dem Institut für Berufspädagogik.
Dabei haben sich die Aufgaben und damit auch meine Rollen doch stark unterschieden. Im ersten Fall war es von außen als Neuer kommend meine Aufgabe, die Arbeit von 15 selbstständigen Erwachsenenbildungseinrichtungen zu koordinieren. Im zweiten Fall habe ich als Mitglied des Senates der Universität Hannover zwar an der Entscheidung mitgewirkt, zwei Fachbereiche und damit auch z.T. zwei Institute zusammenzulegen, aber die konkrete Situation als Betroffener einer solchen Integration tatsächlich zu erleben, stellte sich dann doch anders dar.
Die Aufgabe der institutionellen Selbstständigkeit ist trotz der Vorteile, die man auch im Wissenschaftsbetrieb größeren Einheiten zuschreibt, eine schwere Bürde, vor allem, wenn man sich mit einem Partner zusammentun muss, der mindestens doppelt so groß ist und von seiner Geschichte her in der Universität Hannover weit stärker verwurzelt ist als die Erwachsenenbildung.
Erfahrungen mit der Aufgabe des Optimierens, also Veränderungen einzuleiten, bevor der Druck von außen dazu zwingt, und es vielleicht zu spät ist, d.h. Bewegung anzustoßen gegen den Widerstand der mit dem Status quo zufriedenen Organisationsmitglieder, habe ich in vielen Feldern gemacht und die damit verbundenen Kämpfe und Krämpfe erlebt und erlitten. Derartige Erfahrungen konnte ich während meiner hauptamtlichen Tätigkeit als Leiter der Bildungsabteilung eines großen Industrieunternehmens und später auch als Berater einer Vielzahl anderer Unternehmen machen und nun aufarbeiten. Mein Ansatzpunkt waren hier vielfältige Aktivitäten in der Personal- und Organisationsentwicklung. Anders als die Herangehensweisen der Ingenieure oder der Betriebswirte, die vor allem an dem Produktionslayout arbeiten oder sich an Produktionskennzahlen orientieren, war mein Schlüssel und der meiner Beraterkollegen, die Mitarbeiter zu motivieren, für den Erfolg ihres Unternehmens und damit auch für ihren eigenen durch ihre Ideen einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Ökonomische und humane Ziele gleichermaßen zu verfolgen, indem man Betroffene zu Beteiligten macht, lautete die dahinterliegende Strategie. Die Hauptaufgabe für den Akteur liegt dabei wieder eindeutig in der Moderation solcher Prozesse.
Moderation als zentrale Kompetenz
Die Moderation ist die zentrale Quelle, und zwar für alle Aufgaben, die dem Akteur Einfluss zu sichern vermag. Wer Einfluss ausüben will, ohne sich ausschließlich auf eine Spitzenstellung in der Hierarchie einer Organisation zu berufen, muss diese Aufgabe beherrschen. Voraussetzung dafür ist ein der Führungstheorie entlehntes Verständnis einer kooperativen Führung. Danach wird Führen nicht mit Anweisen oder Überreden gleichgesetzt, sondern als verantwortliche Steuerung der Verständigung auf ein gemeinsam getragenes Tun hin. Führung wird allerdings noch durch den Faktor Macht begleitet, dessen Einsatz hinsichtlich der Wirkung jedoch äußerst fragil ist. Wer sich auf seine Vorgesetztenfunktion als einziges Argument gegenüber seinen Mitarbeitern beruft, hat schon verloren. Dies gilt auch für das Verhältnis eines Vereinsvorsitzenden gegenüber seinen Mitgliedern. Insofern ist die Kommunikation auf einer Augenhöhe, das Überzeugen statt Anweisen aber auch das Zuhören und Abwägen der eigentliche Schlüssel für einen erfolgreichen Einfluss. Dieser Einfluss wirkt jedoch umso nachhaltiger, je stärker er sich auf die Einsicht derer stützen kann, die sich diesem Einfluss nicht nur unterziehen, sondern ihn geradezu suchen.
Dies gilt nicht nur für Wirtschaftsunternehmen, denen wir gemeinhin Rationalität unterstellen, sondern auch für die Vielzahl der Organisationen, in denen wir außerhalb des Berufes freiwillig involviert sind und in denen durchaus die Gefahr lauert, dass die Beziehung zwischen den Mitgliedern zum eigentlichen Thema wird, das die Sachthemen, die durch das Organisationsziel gesetzt sind, überlagert. Insofern ist die Aufgabe der Moderation zwangsläufig und auch durchgängig mit der Biographie von jemandem verknüpft, der sich bislang als Akteur behauptet hat.
Kap. 4 Einflussnahme als Mikropolitik
Wenn wir die Einflussnahme als ein Gestaltungshandeln in einem sozialen Gefüge begreifen, findet ein solches Handeln seine begriffliche Heimat in der Politik. Soweit sich diese auf Organisationen beschränkt, scheint der von Neuberger umfassend aufgearbeitete Begriff Mikropolitik passend zu sein.
Und wenn wir Politik allgemein als das Bemühen verstehen, das Gemeinwesen zu gestalten, beschreibt Mikropolitik das konkrete Verhalten innerhalb der Institutionen und Organisationen, die dieses Gemeinwesen ausmachen. Mikropolitik umfasst das Denken und Tun von Akteuren von der Zielbestimmung über die strategischen Überlegungen bis hin zu dem konkreten Handeln. Dabei ist festzuhalten, dass die Einflussnahme grundsätzlich ein kommunikativer Prozess ist, innerhalb dessen der Sprache und deren Verwendung die zentrale Bedeutung zukommt.
Mikropolitik vollzieht sich dabei immer in dem Spannungsfeld von Individuum und Organisation, von den individuellen Bedürfnissen und Interessen einerseits und den häufig als objektive Notwendigkeit deklarierten Organisationsinteressen andererseits. Dieses Spannungsverhältnis umgrenzt das Spielfeld, in dem mikropolitische Handlungen stattfinden. Die Akteure bedienen sich dabei unterschiedlicher Spielstrategien, die sich durch folgende von Oswald Neuberger aufgestellten und von mir erweiterten Kriterien näher beschreiben lassen:
- Interessen (Warum oder wozu handelt jemand?)
- Intersubjektivität (Welche interpersonellen Beziehungen existieren?)
- Macht (Wie wird das Geschehen beherrscht oder kontrolliert?)
- Dialektik der Interdependenz (Wie wird wechselseitige Abhängigkeit bewältigt?)
- Macht
- Legitimation (Wie werden Handlungen oder Verhältnisse gerechtfertigt?)
- Zeitlichkeit (Wie wird mit Instabilität, Wandel, Chancen umgegangen?)
- Mehrdeutigkeit (Welche Mehrdeutigkeiten, Widersprüche und Interdependenzen erlauben/erfordern „interessiertes Handeln“?)
- Informationsmanagement (Wer steuert wie die Weitergabe von Informationen?)
- Critical Incidents (Wo sind bei der Verwirklichung der Aktionen die kritischen Punkte bzw. die Schlüsselstellen?)
Mit Hilfe dieser Kriterien habe ich meine Erfahrungen aus den zentralen Aufgaben Aufbauen, Retten, Integrieren und Optimierung versucht präziser zu strukturieren. Das Ziel dabei ist, Ansatzpunkte zu finden, wie sich Maßnahmen der Einflussnahme im Nachhinein analytisch erklären aber auch für zukünftige Maßnahmen steuern lassen.
Kap. 5 Einflussnahme und Persönlichkeit
Unabhängig von allen äußeren Einflüssen und auch nicht durch strategische Planungen und taktische Verhaltensweisen ersetzbar, ist es die Persönlichkeit, die es wesentlich bewirkt, ob ein Akteur Erfolg hat oder nicht.
In diesem Phänomen Persönlichkeit ist ein großer Anteil dessen verborgen, was wir als geheimnisvolle Aura bzw. als nicht präzise Fassbares konzedieren müssen. Gerade dies aber macht den Reiz aus, es dennoch zu versuchen. Mein Versuch, dem Geheimnis der Persönlichkeit als Erfolgsgarant näher zu kommen, ist ein von mir skizziertes Strukturmodell[1], das folgende Dimensionen einer Persönlichkeit unterscheidet:
- Visionen
- Welt- und Menschenbild
- Werte und Normen
- Motivationstypen
- Skripte
- Antreiber
- Motive
- Karrierepfeiler
- Durchsetzungsmuster
- Persönliche Projekte
- Gegenwärtige Lebensaufgaben
- Stress- und Konfliktstrategien
- Impression Management
- Interaktionsstil
- Führungsstil
- Konstrukte
- Attribuierung
- Umgang mit Veränderungen
- Autonomieanspruch
- Selbstkonzept
- Kompetenzen
All diese Dimensionen werden dahin überprüft, welche möglichen Auswirkungen sie auf die Ausstrahlung des Akteurs haben, als Person Einfluss ausüben zu können. Diese Überprüfung führt schließlich zu einer eigenen Formel zur Erfassung einer einflussreichen, weil starken Persönlichkeit. Dabei treten Eigenschaften wie Charisma und Authentizität in den Vordergrund, die wiederum Abbild einer gelungenen Identitätsbalance sind. Diese schließlich haben Fähigkeiten zur Rollendistanz, Ambiguitätstoleranz und Empathie als Voraussetzung.
Einflussnahme als Prozess
Der Eindruck als Setzling vom Einfluss
Meine eigenen biographischen Erfahrungen haben mich schon früh davon überzeugt, dass der Eindruck der Setzling vom Einfluss sei. Dabei ist ein Setzling häufig außerhalb vor der realen Umwelt geschützt, gezogen und gepflegt worden, in der Erwartung, dass daraus etwas wird. Übertragen auf die soziale Interaktion zwischen Menschen ist, einen Eindruck zu hinterlassen, eine entscheidende Voraussetzung dafür, identifizierbar zu sein; auch im Austausch von Dritten untereinander. Man kann zu einem Gesprächsthema werden und die anderen wissen, über wen man spricht.
Im Folgenden werden zentrale Mittel thematisiert, mit denen man einen (guten) Eindruck vermitteln kann
Die Passung zwischen Aussage und Sprache herstellen
Bleiben wir in der Assoziation eines Transportes von Inhalten, ist das nächste, was Eindruck macht, die Verpackung. Das heißt, die Art und Weise wie der Inhalt präsentiert wird. Und diese Präsentation hängt nicht unwesentlich von der Formulierungskunst ab. Als Buchautor ist man geneigt, die Formulierungskunst mit der Eleganz der Formulierungen gleichzusetzen, mit einer Wortwahl, die nicht stereotype Wortverknüpfungen bedient, sondern auch neue Kreationen hervorbringt und das Gesprochene oder Geschriebene in einen Rhythmus bringt, der als angenehm empfunden wird. Nur, wer z.B. den unterschiedlichen Musikgeschmack über Gruppen unterschiedlichen Alters oder auch sozialer Zugehörigkeit wahrnimmt, weiß, dass es nicht den Rhythmus gibt, der allen gleichermaßen gefällt. Das gilt auch für die Gestaltung von Wortbeiträgen. Zur Verdeutlichung ein beispielhafter Vergleich. Eine Rede, wie sie Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gehalten hat, bedient, unabhängig vom Inhalt, andere Kriterien für Formulierungskunst, wie z.B. Fritz Münteferings Argument zum Erhalt der Regierungsfähigkeit der SPD auf dem Sonderparteitag im März 2004, als er den Delegierten zurief: „Opposition ist Mist. Lasst das die anderen machen – wir wollen regieren“. Eigentlich handelt es sich um eine schlichte Feststellung, sie hat allerdings so viel Eindruck hinterlassen, dass sie über den damaligen konkreten Anlass hinaus auch für die Zukunft zitierfähig geworden ist, zumindest, was den ersten Teil des Satzes betrifft, „Opposition ist Mist!“.
Auch hier bleibt so etwas wie ein oberstes Wirkungsprinzip gültig. „Die Passung muss stimmen. Für das zuvor skizzierte Beispiel passt die Aufarbeitung der Vergangenheit, die sowohl der Intention der (oder sagen wir besser: der meisten) Deutschen aber auch der ehemaligen Kriegsgegner entsprach, mit der Rhetorik des damaligen Bundespräsidenten zusammen, wie auch der hemdsärmelige Ruf zur Geschlossenheit an die sozialdemokratischen Genossen durch ihren neuen Parteivorsitzenden auf einem Parteitag.
Es gibt aber auch über die Unterschiede hinaus ein Kriterium, das immer wieder als vordringlich genannt wird, übrigens auch in der Partnerwahl. Es ist der Humor.
Die Ausstrahlung des eigenen, persönlichen Engagements.
Ein nicht zu übersehender Aspekt in unserem Bild von dem Inhalt, dem Transport und auch der Verpackung einer Botschaft ist der Bote selbst. Die Relevanz dieses Aspektes steigt umso stärker, wenn derjenige, der den Inhalt produziert, mit dem Boten identisch ist. Wenn nach einiger Zeit dann der konkrete Wortlaut und die Argumentationskette, sei sie noch so unbeschädigt und zuverlässig transportiert und auch noch so schön verpackt, nicht mehr in den Einzelheiten präsent sein mag, der Gesamteindruck wird über die Person, die diesen verantwortet hat, konserviert.
Es sind folgende Signale, die Eindruck hinterlassen.
- Gelassenheit
- Die Ideen anderer nicht durch Zensur blockieren, sondern aufgreifen
- Leichtigkeit und Humor zeigen
- Den missionarischen Eifer zügeln
- Perspektiven bieten
Wer sich gelassen und souverän zeigt, wird von den anderen eher als handlungsfähig angesehen. Er ist nicht im Reptiliengehirn, bleibt vernünftig, weil er noch vernehmen und darauf handeln kann. Seinen Vorschlägen kann man eher mehrheitlich folgen. Das bedeutet allerdings nicht, dass man auf der rationalen Ebene Vorbehalte, die aus der emotionalen Ecke gesteuert werden, mit Statistiken beseitigen kann. So hilft es einem Patienten, der vor einer schweren Operation steht, nicht unbedingt, wenn man ihm vorrechnet, dass diese rein statistisch gesehen zu 91,3 % erfolgreich durchgeführt wird. Im Zweifel wird er seinen Fall in die 8,7 % Misserfolge einrechnen. Auch kann es sein, dass ein unreflektierter emotionaler Ausbruch andere Menschen beeindruckt, allerdings meist nur kurzfristig und dann wohl in der Funktion eines affektiven Rammbockes. Der Akteur wird in solchen Fällen eher benutzt und wird somit weitgehend seiner Chance beraubt, Einfluss im Sinne einer nachhaltigen Wirkung zu entfalten.
Ideen von anderen aufzugreifen fällt vor allem in kontroversen Auseinandersetzungen schwer, weil sie eventuell die Möglichkeit in sich tragen, die eigene Meinung in Gefahr zu bringen. Dass mir an dieser Stelle eine militärische Begrifflichkeit in den Sinn kommt, die ich ansonsten grundsätzlich ablehne, mag symptomatisch für das sein, was ich als falsche Lösung betrachte. In dem Kampf um die Konsistenz der eigenen Position wird selektiv wahrgenommen und die Reihen der Truppen geschlossen, die die gefasste Meinung teilen und gegen die Abweichler in Stellung gebracht. Die Folge davon ist möglicherweise die Verteidigung eines eigenen blinden Flecks, verknüpft mit der Gefahr von denen, die die verteidigte Meinung nicht teilen, fortan nicht mehr ernst genommen zu werden und vom Gegner, mit dem man sich trefflich um den richtigen Weg streiten kann, zum Feind wird, dem man nicht mehr über den Weg traut. Aus einem Sachkonflikt gerät die Auseinandersetzung zu einem Beziehungskonflikt, der in der Regel mehr Narben hinterlässt, als wenn man sich über ein Ding streitet. Wer den Ideen eines anderen seine Berechtigung lässt, gerät nicht so leicht in Gefahr, dass die eigene Meinung abgelehnt wird, weil der andere meint, man wäre in seiner eigenen Beurteilungsfähigkeit doch ziemlich eingeschränkt. Man kann dies auch zupackender formulieren: „Wer so doof ist, mein berechtigtes Argument nicht anzuerkennen, muss auch sonst falsch liegen“. Die beste Form einer konstruktiven Auseinandersetzung ist, die Ideen der anderen aufzugreifen und in eigene Vorschläge einzubinden, vielleicht sogar in einem Kompromiss. Happy Ends allerdings sind auf vielen gesellschaftlichen Feldern nicht an der Tagesordnung. Selbst wenn es am Ende keine Kompromisslösung geben kann, bleibt doch die respektvolle Auseinandersetzung mit den Argumenten der Gegenseite ein wichtiges Element, langfristige Störungen zu vermeiden, die ihren Ursprung meist auf der Beziehungsebene haben. In diesem Sinne ist auch der von vielen als klug empfundene Satz „Vergiss alles, was vor einem aber steht“, doch nicht besonders klug. Er rückt eindeutig das Ergebnis in den Vordergrund und nicht den Prozess, wie es zu Entscheidungen kommt und dieser Prozess fügt manchmal mehr Schmerzen zu als das Ergebnis selbst.
Ein schmerzlinderndes Mittel wiederum bietet der Humor, ein Element, das eine besondere Aufmerksamkeit verdient.
Wenn Humor in empirischen Befragungen, ob auf der Ebene von Boulevardmagazinen oder in ernsthaften wissenschaftlichen Publikationen als eine Eigenschaft genannt wird, die in unserem Lande für besonders wichtig gehalten wird, mag das überraschen. Wenn man einen anderen für besonders überzeugend hält, weil er seine Äußerungen humorvoll vorträgt, wenn der Humor ganz oben steht in den Erwartungen, die man an einen Lebenspartner hat, mit dem man glücklich sein möchte, ist dies gleichermaßen nicht selbstverständlich.
Man kann ja nicht unbedingt behaupten, dass wir Deutschen ein besonders lustiges Volk sind und dass in unseren Ehen Lachen ein zentrales Moment unseres Alltages darstellt. Es muss also etwas anderes hinter dem Aspekt des Humors stecken. Es ist wiederum in der Souveränität, die über den Humor zutage tritt. Es ist die Fähigkeit von oben auf die Welt und deren Probleme zu schauen und damit auch auf sich als Beteiligtem. So jemandem vertraut man sich in der Regel leichter an als jemandem, der durch Aggressionen vernebelt scheint. Wer sich einem Augenzwinkern anschließen kann hat, dem erscheinen gewisse Vorgänge nicht mehr so bedrohlich, wie sie vorher schienen. Dem Dramatischen wird also die Spitze genommen und damit auch der Notwendigkeit, sich zu wappnen oder gleich zurückzuschlagen. Gemeinsam über einen Scherz zu lachen oder über eine humorvoll gelungene Formulierung zu schmunzeln, lässt den gemeinsamen Blick auf ein Problem zu, das damit an Dramatik verliert, und auf der Beziehungsebene wird die gegenseitige Wertschätzung belebt, weil man sich auf einer Metaebene triff, die einen wenigstens ein paar Meter aus den Niederungen der emotionalen Verstrickung heraus hebt. Derjenige, dem es gelingt die humorvolle Distanz in einer Kunstform darzubieten, die den anderen ob des darin zum Ausdruck gebrachten Esprits Genuss verschafft, platziert sich auf der Rangliste derer, die hinsichtlich ihrer Souveränität Eindruck machen, ziemlich weit oben. Wer über die Fähigkeit, etwas zuspitzen zu können, das Florett so geschickt handhaben kann, dass er selbst „schwere Waffen“ zurückhält, fordert zur Bewunderung heraus. Wer dort Leichtigkeit zeigt, wo andere schwer ins Schwitzen kommen oder wild um sich schlagen, deutet an, dass er für noch schwierigere Situationen über Reserven verfügt. Deren Einfluss wiederum vertraut man sich eher an als jemandem, der am Ende seiner Kräfte scheint.
Die Auseinandersetzung mit dem Kriterium missionarischer Eifer muss differenziert stattfinden und vor der Zielsetzung dieses Buches und von der Vorstellung des von der Manipulation unbelasteten Einflusses leiten lassen. Langfristig und vor dem Hintergrund einer rationalen von der Aufklärung geprägten Bewertung des Einflusses ist die Wirkung dann nachhaltig, wenn einem missionarischen Eifer Einhalt geboten wird. Dennoch kann man der Tatsache nicht widersprechen, dass gerade der missionarische Eifer Diskussionen beherrscht, wenn es um grundsätzliche vor allem politische Entscheidungen geht. Die Diskussion vor und nach dem Brexit, also in der Zeit, in der Teile dieses Buchmanuskriptes entstanden sind, hat wieder einmal nachdrücklich bewiesen, wie irrational solche Diskussionen geführt werden und von Sachkonflikten zu Glaubenskriegen werden. Solche Glaubenskriege entledigen sich der Überprüfbarkeit und nähren sich aus dem Geschick, die Apokalypse auszumalen, die einem droht, wenn man dem Teufel bzw. dem Falschgläubigen folgt. Zu glauben hat meines Erachtens dort eine Berechtigung, wo unsere rationalen, vor allem naturwissenschaftlichen Erklärungen nicht mehr genügen, wo z.B. aus dem Physiker ein Philosoph wird, nicht aber dort, wo rationale Begründungen, die wissenschaftlich nachgewiesen sind, auf einmal durch Glauben verdrängt werden. Ein Beispiel hierfür aus den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Der Sohn eines Tierarztes, der auf die Abstammung des Menschen vom Affen verweist, wird von dem Religionslehrer mit folgenden Worten abgekanzelt: „Wenn das bei euch zu Hause der Fall ist, na, ja. Merk dir: der Mensch wurde von Gott als sein Ebenbild geschaffen.“
Ein Hinweis: Der Unsinn von irrationalen Entscheidungen ließ sich schon unmittelbar nach der Brexit-Entscheidung erkennen. Ratlosigkeit, welche konkrete Konsequenzen daraus zu ziehen sind, schlugen sich in der Strategie nieder, den endgültigen Ausstieg aus der EU möglichst lange hinauszuzögern. Hätte man genügend konkrete und stichhaltige Gründe für das Verlassen der Gemeinschaft, wäre man sicherlich schneller in der Umsetzung der „neuen Unabhängigkeit“. Besonders verwerflich ist es, eigennützige Interessen zu solchen Glaubenskriegen auswachsen zu lassen, wie er von David Cameron angefacht wurde. Die gesamte europäische Idee dem Versuch zu opfern, über ein Referendum die eigene Macht in der eigenen Partei zu sichern, grenzt an Demagogie. Immer wieder sind derartige Machspiele zu beobachten. Auch in Deutschland haben wir genug Beispiele, so z.B. 2005 durch Gerhard Schröder, als er nach der Wahlpleite bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, eine Bundestagswahl ansetzte, um durch diesen Husarenstreich seine Macht zu retten. Auch dies ist schiefgegangen, allerdings mit nicht solch gravierenden Auswirkungen, wie von Cameron verursacht. Der Wechsel von Schröder zu Merkel hatte kein vergleichbares Erdbeben ausgelöst, was wohl daran liegt, dass die Strategie beider Parteien darin liegt, die Stimmen in der Mitte zu holen. Die Folge ist, dass sich deren für die Bürger spürbare Politik, kaum mehr voneinander unterscheidet. Und wenn man ein politisches Zwischenfazit zieht, hat ein Prozess stattgefunden, den man als Sozialdemokratisierung der CDU bezeichnen kann.
Perspektiven bieten zu können wird erleichtert, wenn die vorigen Kriterien erfüllt sind. Aus einem leicht erhöhten Blickwinkel, erreicht über einen humorvollen Zugang über Gelassenheit und Leichtigkeit und auch durch das Zügeln eines missionarischen Eifers, ist schließlich auch die Sicht frei für Überlegungen, eine in welche Richtung es weitergehen könnte, um anstehende Probleme lösen zu können. Wer zusätzlich zur Richtung auch noch Meilensteine setzen und Hilfen bei den ersten Schritten leisten kann, kann sich sicher sein, dass andere ihm vertrauen und seinen Einfluss damit fördern. Man kann davon ausgehen, dass die, auf die Einfluss ausgeübt wird, die Person, die Perspektiven anbietet, auch diejenige ist, mit der man die Perspektiven am ehesten zu verwirklichen glaubt.
Außer den Anlässen, die einem passieren können und die man als Akteur für den eigenen Einfluss nutzen kann gibt es schließlich noch andere Ansatzpunkte um als Akteur im sozialen Kontext gestalterisch agieren kann, und dies sogar als Profession. Ein Beispiel soll näher beleuchtet werden
Optimieren – Changemanager und Organisationsentwickler
Fälle:
Steuerung von einem Unternehmensleitbild aus.
Die bisher dargestellten Anlässe und daraus erwachsenden Aufgaben für einen Akteur, der Einfluss nehmen will, sind im Sinne meiner Einführung „passiert“, sind also Ereignisse, die wir in ihrer Entstehung nicht beeinflussen können, wohl aber hinsichtlich ihrer Folgen. Wir können lediglich etwas daraus machen.
Anders verhält es sich bei der Aufgabe des Optimierens. Hier fallen einem die Einflusschancen nicht in den Schoß. Hier sind Akteure als Verursacher gefragt. Sie produzieren Ereignisse, um Veränderungen gezielt in Gang zu bringen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um Selbstläufer. Im Gegenteil, Bemühungen etwas von innen heraus zu verändern also ohne spürbaren Zwang von außen, stoßen häufig bei den Mitarbeitern auf Desinteresse oder sogar auf Widerstand. „Warum sollen wir etwas ändern, wo doch alles zur Zufriedenheit läuft?“ Es ist eine zentrale Aufgabe des Managements, oder benutzen wir hier besser den Begriff Unternehmensführung, ein solches Gefühl nicht aufkommen zu lassen. Dabei hängt es von ihrem Geschick ab und hier handelt es sich in erster Linie um eine kommunikative Kompetenz, das Unternehmen in Bewegung zu halten, ohne dabei in einen nicht vermittelbaren Aktionismus zu verfallen. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit im Unternehmen wach zu halten, um zukünftigen Anforderungen gerecht werden zu können. Dazu gehören nicht nur Pläne, was man machen könnte, wenn…, sondern aktives, präventives Handeln.
Ein solches Handeln kann auf unterschiedlicher Weise bzw. auf unterschiedlichen Ebenen gesteuert und befördert werden. Auf den Ebenen des
- Wollens
- Könnens und
- Tuns
Mittel, die ein vorausschauendes Denken und Handeln auf der Ebene des Wollens befördern, liegen im Vorhaben der Selbstreflexion über dem Sinn des Unternehmens und seinen Ressourcen, diesem Sinn gerecht werden zu können. Kurz: Es geht um ein Unternehmensleitbild, d.h. um eine Unternehmensphilosophie, die eine konsequente Fortsetzung in einer entsprechenden Strategie und die sie ausfüllenden konkreten Maßnahmen findet.
Auf der Ebene des Könnens geht es um alle Anstrengungen, die richtigen Mitarbeiter zu finden, sie richtig einzusetzen und mit Hilfe von Personalentwicklungsmaßnahmen zu pflegen.
Auf diesem Wollen und Können aufbauend, geht es um die richtige Umsetzung in ein konkretes Tun. Hierzu dienen Organisationsentwicklungsmaßnahmen und Projekte allgemein, die sich z.T. auch quer zur sonstigen Organisation mit der konkreten Ausgestaltung der Arbeitsabläufe befassen.
Die Steuerung aus einem Leitbild heraus ist nicht nur für Unternehmen denk- und auch anwendbar, sondern auch für eine wissenschaftliche Einrichtung. Am Beispiel der Universität, in der der Autor tätig war, wird das in dem Buch konkretisiert. Vorab ist jedoch zu klären, welche Aufgabe eine Universität bei der Vermittlung von Erkenntnissen an ihre zentrale Klientel, die Studierenden, zu übernehmen hat. Es geht dabei vor allem um die hochschuldidaktische Gestaltung einschließlich der Feststellung, inwieweit die Studierenden ihr Studienziel erreicht haben. Hinter solchen Regelungen verbergen sich Vorstellungen über die gesellschaftliche Funktion, die man der Alma Mater grundsätzlich zuweist.
Übertragung der Leitbildsteuerung auf eine Universität.
Eine unbedingt notwendige hochschuldidaktische Diskussion dürfte allerdings nicht auf die Weitergabe von Tipps beschränkt bleiben, wie man die Studierenden bei Laune hält, sondern müsste die gesamte Lehr- und auch Prüfungsstruktur umfassen, denn der Bologna-Prozess, auf den Bildungspolitiker und auch Hochschullehrer wie Lemminge reagieren, führt zu einer Verschlechterung der hochschuldidaktischen Chancen. Das Abarbeiten von Modulen, die ständige Überprüfung von Lernerfolgen, die Vergabe von Credit Points entsprechend dem häufig willkürlich erdachten work load, beschädigt die in unserem Lande so beispielgebende Wissenschafts- und Lehrkultur an unseren Universitäten. Das Sammeln von Credit Points, zu dem man Studierende verpflichtet, hat zwangsläufig die Entsprechung in einem vorgeschriebenen Lehrkatalog und fördert die Unsitte von Vorlesungen, deren Sinn bzw. Un-Sinn folgendes Begebenheit in Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Weiterbildungsstudiengang bezweifelt werden muss mit dem kritisierten Professor als Protagonist. Der Kollege begründete seinen raschen Abschied aus einer Sitzung damit, dass er seine morgige Vorlesung vorbereiten müsse. Auf meine Frage, was er denn noch konkret tun müsse, antwortete er: „Ich muss meine Sprechgeschwindigkeit einstellen, damit ich mit dem Stoff für diese Sitzung durchkomme, denn wenn ich in jeder Sitzung fünf Minuten verliere, schaffe ich mein Pensum nicht“. Ich denke, diese Begebenheit spricht für sich selbst. Bleibt also nur der Rat an die um die Finanzen besorgten Politiker: Sparen sie diesen Kollegen als Hochschullehrer ein und investieren in eine genau getaktete Videoaufnahme, die den Studierenden dann jeweils vorgespielt wird. Bei diesem Verfahren werden noch genug Mittel übrig sein, um sich bekannte Schauspieler als Synchronsprecher leisten zu können.
Wenn Studierende aufgrund der zunehmenden Abhängigkeit, verankert in der Anwesenheitspflicht und den Credit Points, sich heute weniger wehren können als noch vor 30 Jahren, mögen finanzstarke Kunden über Weiterbildungsstudiengänge für eine Qualitätssteigerung in der universitären Lehre sorgen. Denn eines habe ich eindrucksvoll erfahren, die Lehrqualität in der betrieblichen Weiterbildung ist der in den Hochschulen meistens voraus. Wer für Lehre bezahlt, fordert auch Qualität, und wer sie nicht leistet, bekommt keinen Auftrag mehr. Geld ist und bleibt, auch bei so hehren Themen wie der wissenschaftlichen Bildung, ein nicht zu unterschätzendes Steuerungsmittel.
Der Autor hebt bei den professionellen Aktivitäten zur Um- und Neugestaltung von Organisationen, ob es sich um Unternehmen oder öffentliche Einrichtungen handelt, die Methode der Organisationsentwicklung hervor und unterstützt sein Plädoyer für diesen strategischen Ansatz durch die Aufarbeitung von ihm selbst begleiteten Veränderungsprozessen.
Steuerungsansatz Organisationsentwicklungsmaßnahmen.
Unter Organisationsentwicklung verstehe ich mit Lutz von Rosenstiel einen „längerfristig angelegten organisationsumfassenden Entwicklungs- und Veränderungsprozess von Organisationen und der in ihr tätigen Menschen. Der Prozess beruht auf Lernen aller Betroffenen durch direkte Mitwirkung und praktische Erfahrung. Das Ziel besteht in der gleichzeitigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Organisation (Effektivität) und der Qualität des Arbeitslebens (Humanität) (von Rosenstiel u.a. 1988, S.26).
Organisationsentwicklung dient also der Verknüpfung von ökonomischen und humanen Zielen. Voraussetzung, dass die gelingt, ist die Beteiligung der Betroffenen, die innerhalb des Veränderungsprozesses gemeinsam Erfahrungen machen und daraus lernen. Organisationsentwicklung ist damit etwas anderes als eine von irgendeinem Entscheidungsträger verordnete Organisationsveränderung, indem z.B. Organigramme verändert oder vom grünen Tisch aus neue Produktions-Layouts konstruiert werden. Organisationsentwicklung setzt auf das Expertentum der Betroffen und beugt Widerständen vor, die auf dem bekannten Muster beruhen: „War ich nicht dabei, bin ich dagegen“. Damit trägt sie der Tatsache Rechnung, dass Organisationen nur durch die in ihr tätigen Menschen lebendig und Veränderungen nur über die sie tragenden Menschen wirksam werden.
Insofern ist die Art und Weise, wie man an Veränderungen herangeht, ein wesentliches Kulturgut für die Gestaltung eines lernenden Unternehmens. Wer als Mitarbeiter die Erfahrung macht, dass er bei Veränderungen um seinen Rat gefragt wird und die Sicherheit spürt, dass bei negativen Erfahrungen mit den Veränderungen diese zurückgenommen oder in eine andere Richtung korrigiert werden, wird zum Lernen angeregt sein und die Bereitschaft entwickeln, Lernerfahrungen abzugeben und auch von anderen zu übernehmen.
Damit erhalten OE, Veränderungs- und Lernkultur eine beträchtliche Schnittmenge.
Als eigenes zentrales Element einer Veränderungs- und Lernkultur kann man die Bereitschaft, sich auf etwas Neues einzulassen und Neugier zu zeigen, hervorheben. Dazu kommt noch die Toleranz Fehler machen zu dürfen und die Motivation aus Fehlern zu lernen. Für Führungskräfte gilt es, eine solche Neugier selbst vorzuleben, zur Neugier anzuregen und, wenn sich diese zeigt, auch zu fördern. Nichts fördert die Bereitschaft, Neues entdecken zu wollen, stärker als die Erfahrung, die man bislang gemacht hat, wenn man sich auf Neues eingelassen hat. Sich einlassen, bedeutet Kompetenzerweiterung und Kompetenzerweiterung wiederum erhöht die Neugier.
Organisationsentwicklung führt zu einer Kultur, in der Veränderungen durch die Betroffenen mitgetragen werden, weil ihre Befürchtungen nicht übergangenen oder überrollt werden, weil sie nicht als Hindernisse betrachtet werden, sondern als Ansatzpunkte für Ideen, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Neuerungen nachhaltig wirken können. Das Bemühen, Einfluss zu nehmen, muss dabei Abschied nehmen von dem Auftritt eines Zampanos, und sich mit dem Bild eines Prozessförderers anfreunden. Das ist kein realitätsfernes Wunschbild, sondern notwendiges Kalkül. Auch eine Unternehmenswelt lässt sich nicht von heute auf morgen durch die Anweisung eines Topmanagers ändern, sei dieser auch noch so mächtig. Hier geht es nicht darum, durch einen Heldenstreich in die Geschichte eines Unternehmens einzugehen oder sich den Platz auf dem Cover eines Managermagazins zu sichern, sondern um „das Bohrern dicker Bretter“, das nicht immer publikumswirksam in Szene gesetzt werden kann.
Organisationsentwicklung hat, wie aus der Definition von Lutz von Rosenstiel ersichtlich, zwei Antriebsquellen. Zum einen die Ökonomie und zum anderen die Humanität. Also, einmal das Bestreben, möglichst wettbewerbsfähig zu bleiben, vor allem durch ein effizientes Arbeiten, zum anderen aber auch dieses Arbeiten so zu gestalten, dass es humanen Ansprüchen genügt.
Insofern konzentrieren sich Anstöße zu Organisationsentwicklungen meistens auf der Suche nach Stellen in Arbeitsprozessen, die nicht reibungslos laufen, weil Schnittstellen nicht richtig gemanagt werden oder weil sich an diesen Stellen „Fett angesetzt“ hat. Letzteres ist für jeden erkennbar, der aktiv in Arbeitsprozessen steckt oder davon tangiert wird. Häufig wird an Dingen festgehalten, die sicherlich einmal nötig waren, inzwischen aber nicht mehr erforderlich sind, aber einfach mitgeschleppt werden. Etwas abzuschaffen, ob es Personal oder Formulare sind, fordert meistens zu Widerstand heraus. Deshalb versteift man sich auf ein Verfahren, das Alte zu belassen und durch Neues zu korrigieren, oder Zusätzliches einfach draufzusatteln. Dafür gibt es genug Beispiele in der deutschen Wirtschaft. Ein Paradefall für eine solche Entwicklung sind Unternehmen der Energiewirtschaft (gewesen). Ihnen wurde nachgesagt, über eine Lizenz zum Gelddrucken zur verfügen. Üppige Gehälter, auch für Mitarbeiter in den Kraftwerken, und auch eine großzügige Ausgestaltung der Rahmenbedingungen auf allen Ebenen waren deutliche Merkmale. Wenn an diesen nun restriktive Maßnahmen ansetzen, aufgrund der Veränderungen in der Energiepolitik, tut dies den betroffenen selbstverständlich weh, und ebenso selbstverständlich wird nach entsprechenden Heilmitteln gerufen und die lagern bekanntlich in den öffentlichen Kassen.
Unternehmen aus anderen Wirtschaftszweigen, die nicht ganz so begütert waren, mussten sich schon viel früher und gewissermaßen als ständiges Prinzip auf die Suche nach organisatorischen „Speckbäuchen oder Speckröllchen“ machen, um auf dem Markt bestehen zu können. Hat man die Möglichkeiten, diese aufzudecken, hat man dann auch die Möglichkeiten, an diesen gezielt zu arbeiten. Gelingt es darüber hinaus einen Weg zu finden, der Wirtschaftlichkeit und humane Arbeitsbedingungen nicht als konträre Faktoren erscheinen lässt, sondern sie in diesem Sinne in Einklang zu bringen, dass mehr Humanität zu mehr Gewinn führt, hat man den Schlüssel für ein erfolgreiches Vorgehen gefunden. Wenn man mit humanem Arbeiten auch den Anspruch verbindet, unsinnige Arbeiten zu vermeiden, spricht nichts dagegen, unsinnige Arbeitsschritte abzuschaffen. Dies gelingt allerdings nur dann, wenn sich Veränderungen nicht nur auf die Vorschriften beschränken, sondern sich in dem Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter manifestieren. Menschen können sehr wohl zwischen Vorschriften und dem eigenen Verhalten trennen. Wenn sie Vorschriften nicht einsehen, werden Sie genug Phantasie besitzen, diese für sich umzuinterpretieren und sich weiterhin so zu verhalten, wie sie es bislang gewohnt waren. Insofern ist es eine Grundvoraussetzung für das Gelingen einer OE-Maßnahme, dass folgende Voraussetzungen geschaffen werden müssen:
- Ein Problembewusstsein dafür, dass etwas verändert werden muss
- Die Betroffenen zu Beteiligten an den angestrebten Veränderungen zu machen
- Prozesshaft vorzugehen und
- Die Beziehungsebene ebenso einzubeziehen wie die Sachebene.
Hat man die Betroffenen insofern ins Boot geholt, als sie selbst der Meinung sind, dass etwas verändert werden müsste, hat man schon den ersten entscheidenden Schritt getan. Diesem werden weitere ebenso erfolgreiche folgen, wenn man die Betroffenen miteinbezieht, wenn es darum geht, in welche Richtungen diese Veränderungen vollzogen werden sollen. Wenn die Mitarbeiter erkennen, dass nicht über ihren Kopf bzw. vom grünen Tisch aus entschieden wird, was konkret angefasst werden soll, sondern dass man auf sie als Experten ihres Berufsalltages hört, werden diese mitmachen, vor allem wenn es ihnen bei ihrer Arbeit hilft. Bei der Sammlung von Veränderungsvorschlägen und auch bei deren Umsetzung dürfen ruhig auch Fehlgriffe dabei sein, da man das Vorhaben als einen Prozess begreift, bei dem man etwas ausprobieren kann, und zwar mit einem offenen Ausgang. Man kann also einen Plan verwerfen oder ihn nachjustieren, wenn die Alltagserfahrungen dies nahelegen. Solch ein Ausprobieren steht zwar im Widerspruch zu einem Verständnis von Management, das Entscheidungen zunächst einmal als festgefügte Größe begreift, an der nicht gerüttelt werden darf, weil sie auf kompetenten Vorüberlegungen fußt. Etwas auszuprobieren, ist die Sache von Künstlern und nicht von Managern, die wissen, was sie tun und deshalb ihre Positionen erreicht haben. Ein solches Denken endet häufig in gegenseitigen Schuldzuweisungen und in Taktiken, nicht alles, was man macht oder nicht macht preiszugeben. Insofern ist ein solches Vorgehen als ein gemeinsamer Lernprozess zu verstehen, für dessen Akzeptanz man Überzeugungsarbeit leisten muss. In der Konsequenz bedeutet dies, entsprechend der Grundidee von lean production, die Verantwortung weitgehend dorthin zu verlagern, wo die Arbeit konkret geleistet werden muss. Für denjenigen, der sich zum Akteur einer solchen grundlegenden Veränderungsidee macht, ist Wissen und möglichst auch Erfahrung darüber erforderlich.
- Wie man ein Problembewusstsein erzeugt
- Wie man Betroffene zu Beteiligten macht
- Wie man einen solchen Prozess steuert und wie man es denjenigen, die ein schnelles, fertiges Ergebnis erwarten, beibringt, dass es sich hier um einen Prozess handelt, der seine Zeit braucht
- Wie man Beziehungsfragen zum Thema macht (allerdings nicht zum Selbstzweck) und dies vor allem innerhalb der auf die Sachebene fokussierten Wirtschaftswelt begründet
Veränderungsprozesse zu gestalten, heißt, sich zusammen mit den von den Änderungen Betroffenen, auch um Detailfragen zu kümmern, die z.T. erst im Verlauf des Prozesses in ihrer vollen Bedeutung zu Tage treten, wie folgendes Beispiel bei der Implementierung von sich selbst steuernden Gruppen in der Produktion zeigen.
Der Verlust der offiziellen Führungsfunktion als Degradierung
Unmittelbare Vorgesetzte, wie Schichtführer, Meister und Gruppenleiter, werden bei der Ankündigung, in ihrem Bereich werde Teamarbeit eingeführt, sich erschrocken fragen: „Und was wird aus mir?“ Und umgekehrt wird sich das Unternehmen die Frage stellen: „Was machen wir mit diesen Personen?“
Dabei steht der Verlust des Arbeitsplatzes, wie in dem konkret hier geschilderten Falle und auch bei anderen von mir begleiteten Vorhaben, wohl kaum in Frage, allerdings dessen Veränderung auf eine Art und Weise, die die Führungskräfte als Bedrohung, zumindest aber als Degradierung empfinden. Dieses Empfinden wird nicht dadurch gemindert, dass man – wie im konkreten Falle – die ehemaligen Schichtleiter zu einem „Innovationsteam“ zusammenstellen wollte. Der Grund liegt wohl darin, dass der Aufstieg, dessen erste Stufe man als Schichtleiter geschafft hatte, generell mit Führung von Mitarbeitern verbunden wird. Führungsseminare leitet der Autor gerne mit der Polarität: „Führung – Lust oder Last?“ ein und lässt die Teilnehmer auf einer Skala zwischen diesen Positionen punkten. Nach anfänglichen, von den Teilnehmern als sozial erwünschten Wortschöpfungen, wie zum Beispiel „Verantwortung tragen macht mir Freude“, kommen häufig dann auch Statements: „Ich bin jedes Mal erfreut und überrascht, dass Mitarbeiter einfach das tun, was ich sage, weil ich ihr Chef bin.“ Diese Lust zu führen ist wohl dann noch besonders ausgeprägt, wenn sie neu ist, weil man zuvor noch zu denen gehörte, die als letztes Glied in der Hierarchie-Kette es nur kannten, geführt zu werden.
Führung ist noch mit einem zweiten elementaren Aspekt verbunden, und zwar dass sich Führung in ihrer Bedeutung zusätzlich noch wie folgt quantifizieren lässt: „Ich habe soundso viele Mitarbeiter unter mir.“ Da ist die Auskunft auf die Frage, „Was machst du beruflich?“, wie sie im Bekanntenkreis gerne gestellt wird, „Ich bin Mitglied in einem Innovationsteam“ nicht so wirksam, als wenn man auf die Zahl seiner „Untergebenen“ verweisen kann.
Die Zahl als „Duftmarke der Bedeutsamkeit“ hat ihre Wirkung nicht verloren. In selbstkritischer Betrachtung der eigenen Verhaltensweise muss der Autor feststellen, dass er selbst nicht gefeit ist, solche Marken zu setzen. Als ein Kollege ihm – wahrscheinlich nach einer nervtötenden Fachbereichsratssitzung zum Trost – sagte, er, der Autor, sei in seiner Funktion als Dekan des Fachbereiches Erziehungswissenschaften der Universität Hannover, weil dieser nicht in Institute gegliedert ist, Chef der größten universitären Einzeleinrichtung der Bundesrepublik Deutschland, hatte dies eine enorm aufbauende Wirkung. Wie ist diese Bedeutung nun gegenüber anderen Menschen, die sich in der Hochschullandschaft nicht auskennen, zu vermitteln? Auch die Nennung des Verantwortungsbereiches während seiner Tätigkeit in der Industrie, er sei für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter aller deutschsprachigen Standorte von Hannover bis Traiskirchen (bei Wien) zuständig, ist gut geeignet, Respekt bei den anderen auszulösen, dieser bleibt allerdings in dem rudimentären Bemühen, Rangordnungen herzustellen, relativ vage.
Die Zahl der unterstellten Mitarbeiter sich vorzuhalten, ist ein universell kommunizierbares Signal, dem man wiederum universelle Gültigkeit zuweist. So verhalten sich Erwachsene wie Kinder, die im Streit untereinander versuchen, die Vasallen aufzuzählen, die sie im Konfliktfall aufbieten können. Zunächst angefangen bei den größeren Brüdern, über den Vater und dessen Geschäftskollegen. Wer auf einen Vater verweisen kann, der in einem Großunternehmen oder einer anderen Großorganisation beschäftigt ist, hat gute Chancen zu gewinnen. Ist der Vater nun sogar bei der Bundeswehr, hat man nur die Chance, dieser Bedrohung durch ein Bekenntnis zum Pazifismus zu entkommen. Doch wem gelingt dies als Kind oder auch als Erwachsener, wenn man wieder dazu regrediert.
Was hier ironisch skizziert wird, stellt sich als Auswirkung der Entscheidung dar, die im Laufe der Industrialisierung die Unternehmen getroffen haben, und zwar ihre Organisation stark an dem Modell des Militärs auszurichten. Dass die Führung von Mitarbeitern immer noch das gewichtigste Kriterium für die Positionierung in einem Unternehmen darstellt, weisen die erheblichen Schwierigkeiten nach, die Unternehmen haben, wenn sie neben der Führungslaufbahn eine Fachlaufbahn etablieren wollen, die auf vergleichbaren Stufen einander entsprechende Gratifikationen vorsieht. So bleibt doch immer der „Makel“, dass man auch auf einer oberen Ebene geführt wird, ohne andere zu führen. Dennoch scheint mir die Gleichberechtigung von einer Fachlaufbahn mit einer Führungslaufbahn gegenwärtig die einzige Lösung zu sein, die ihre Basis in einer Projektorganisation haben könnte, in der Führung auf Zeit zu einem zentralen Kulturelement wird.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass, wie auch immer individuell begründet, der Machtverlust der Personen, die ihrer Führungsfunktion beraubt werden, ein Hindernis in der Verwirklichung der Teamidee darstellt. Dieses Hindernis wird umso größer sein, je stärker es dem Betroffenen gelingt, seinen im Laufe der Jahre gewonnenen Einfluss und die gesponnenen Netzwerke zu nutzen, um offen oder versteckt Widerstand zu leisten. Wenn er dann noch Unterstützung durch einen oberen Entscheidungsträger – ob offiziell oder inoffiziell – erhält, erscheint das Hindernis als nahezu unüberwindlich.
Kap. 4 Strategien und Mittel der Einflussnahme
Das Verhältnis von Individuum und Organisation als Raum für Strategien und Mittel
Die Organisation begegnet jedem Akteur in zweifacher Hinsicht. Sie ist zum einen Raum für Handeln, aber auch Mittel zum Handeln. Sie begrenzt einerseits die Beliebigkeit individueller Handlungsfreiheit und ermöglicht aber auch die eigenen Handlungsziele durchsetzen zu können. Zunächst einmal innerhalb der Organisation selbst, indem dort Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse stattfinden, die aus einem individuellen Streben ein gemeinschaftliches machen und damit mehr Kraft verleihen können. Dies wiederum ist Voraussetzung dafür, dass die individuellen Interessen nach außen als Organisationsinteressen artikuliert werden können, wodurch deren Realisierungschancen wachsen.
Sucht man nach einer möglichst umfassenden Definition von Organisation, findet man in Gablers Wirtschaftslexikon eine solche. Trotz der Brille, die einem die Betriebswirtschaftslehre verpasst, scheint diese Definition auch auf andere Organisationsformen, als nur auf Wirtschaftsunternehmen, übertragbar zu sein. Dort definiert man von Organisation als ein „formales Regelwerk eines arbeitsteiligen Systems“. Von Organisationen spricht man, „wenn mehrere Personen in einem arbeitsteiligen Prozess mit Kontinuität an einer gemeinsamen Aufgabe infolge eines gemeinsamen Zieles arbeiten. Die auf Einzelpersonen verteilten Arbeitshandlungen sind dabei aufeinander abzustimmen und auf das gemeinsame Ziel hin auszurichten. Es sind diese Merkmale, die Unternehmen, Vereine, Verbände, etc. als Organisationen von anderen Menschenansammlungen, wie der Warteschlange an der Bushaltestelle unterscheiden.“[2]
In Zusammenhang mit der Kunst der Einflussnahme rückt vor allem das Verhältnis von den Personen zu der so bezeichneten Organisation in den Fokus. Wie verhalten sich die einzelnen Individuen zu dem Gebilde der Organisation. Für einige organisationswissenschaftliche Ansätze sind die Menschen in einer Organisation von nachrangiger Bedeutung, wichtiger sind vor allem die Handlungen, die in einem solchen Gebilde bewusst koordiniert werden, wobei die Menschen durchaus austauschbar sind.[3] Diesem Ansatz kann ich nicht folgen. Zweifellos sind die Menschen anders als außerhalb, z.B. im Freizeitbereich, innerhalb einer Organisation in ihrer Funktion bestimmten Rollenanforderungen unterworfen. Der Banker, der seinem Sportkameraden beim abschließenden, gemütlichen Beisammensein großzügig ein Bier ausgibt und einen edlen Brandy dazu, wird, wenn man ihn in seiner Bank wegen eines Kredits aufsucht, weniger spendabel sein. Der Arzt, der mit seinem Nachbarn über den Gartenzaun eine Zigarette raucht, wird, wenn er diesen auf seiner Station in dem Krankenhaus, im Bett liegend trifft, dies wohl nicht wiederholen. Selbst innerhalb einer Organisation werden sich die Rollen und damit auch die Erwartungen mit neuen Funktionen verändern. Identitätstheoretisch formuliert, verändert sich durch die Balance zwischen personaler Identität (dem Bild von sich selbst) und der sozialen Identität (der Rollenerwartungen von außen) auch die erstere, da sie genährt und immer wieder verändert wird, durch die Vielzahl der Interaktionen im Lebensalltag. Man kann diesen Prozess aber auch weniger blutleer verdeutlichen.
Als ich zum Dekan unseres Fachbereiches gewählt wurde, wurden fortan Äußerungen von mir von den Kollegen mit der Einleitung weitergegeben: „Der Herr Dekan, hat gesagt“, und die älteren Professorenkollegen formulierten: „Spektabilis haben gesagt…“. Nur die Studenten sagten, in der Tradition der „Alt-Achtundsechziger“: „Auch der Lothar hat gesagt…“. Und wer genau hinhörte und das Gesagte im Kontext interpretierte, konnte vor allem durch das „auch“ heraushören, dass „der Lothar“ sich nun mit dem würdevollen Amt zusammen zu einem Autoritätsbegriff entwickelt hat. Dass die Zuweisung von Autorität durch ein Amt nicht ohne Folgen für das Selbstbild bleibt, konnte ich selbst hautnah erleben. Wenn ich um die Gebäude meines Fachbereiches herumging, der ein ganzes Straßenareal umfasste, konnte mich schon das Gefühl beschleichen, König eines kleinen, eigenen, wenn auch von Untergang bedrohten Reiches zu sein. Allerdings nur ganz kurz und vor allem ganz heimlich.
Trotz all dieser Einschränkungen verstehe ich das Verhalten von Individuen in einer Organisation nicht als reine Rollenübernahme (role-taking); es bleibt noch genügend Spielraum für die persönliche Gestaltung im Sinne von role-making. Nur so entwickeln sich Organisationen weiter und sind damit überhaupt in der Lage, mit ihrem sich verändernden Umfeld zu kommunizieren. Die Leser mögen sich nur einmal vorstellen, wenn die heutigen Jugendlichen mit ihrem Verhalten und ihrer medientechnischen Ausstattung heute auf Lehrer aus der Zeit und Kultur der Feuerzangenbowle treffen würden. Für eine Filmlänge könnte man sich darüber noch köstlich amüsieren, mehr und länger aber nicht.
In einer Organisation und vor allem in Unternehmen finden jenseits der Prozesse der Rollenfindung weitere Prozesse statt, die noch stärker mit dem Bedürfnis nach Selbstbehauptung der Einzelnen gegenüber der Organisation verknüpft sind als die, wie man eine Rolle ausfüllt. In Rollen kann man reinschlüpfen und sie mit einigem ebenso großen Vergnügen wie Distanz spielen und dann wieder verlassen. Wenn es aber um existenzielle Fragen geht, ist das eigene Vergnügen wohl kaum mehr das Thema.
Ein selbst erlebtes Beispiel mag den Rahmen verdeutlichen, in dem die Balance gefunden werden muss, für die Anpassung an ein Rollenmuster und der eigentlichen Befindlichkeit, die damit verbunden ist. Im Rahmen der Neuausrichtung eines Personalentwicklungskonzeptes für das obere Management hat mich ein großer deutscher Versicherungskonzern um Unterstützung gebeten. Bei einem Treffen mit einem jungen Abteilungsleiter hat mich dieser zum Mittagessen im Hause eingeladen. Kurz vor dem Eingang zur Kantine stoppte er, nahm mich zur Seite und bat mich nicht darüber verwundert zu sein, was nun passieren würde. Er öffnete eine Seitentür und wir befanden uns in einem Speiseraum, der den leitenden Angestellten vorbehalten war. Dort saßen rund vier Dutzend Männer in ihren dunklen Anzügen beim Essen. Eine Frau, ebenfalls dunkel gewandet in einem Hosenanzug, war auch dabei. Er bat kurz um Aufmerksamkeit und stellte mich kurz selbstverständlich mit allen Titeln und Ehrenzeichen den Anwesenden vor, was mit einem dezenten Klopfen der Anwesenden beantwortet wurde. Als wir an einem der Tische Platz nahmen, wurden wir rasch bedient von den Servicekräften, die mich sofort mit Namen ansprachen und, wie ich im Verlaufe meines Aufenthaltes an diesem geheiligten Ort feststellen konnte, auch alle anderen Stammgäste. Das Essen war allerdings das gleiche wie in der Hauptkantine. Der Unterschied zu den weniger Privilegierten bestand in der Bedienung und der persönlichen Ansprache und vor allem daran, dass man unter sich war. Dieses unter sich sein wurde noch dadurch verstärkt, dass man sich nach dem Essen noch in Sitzecken niederlassen und einen Kaffee zu sich nehmen konnte. Ohne darauf angesprochen zu werden, erfolgte von meinem Gastgeber eine Erklärung zu dem, was ich hier erleben konnte. Das gemeinsame Essen unter den leitenden Angestellten wird offiziell mit der Möglichkeit begründet, sich auf kurzem Wege miteinander austauschen zu können. Er räumte selbst ein gewisses Unbehagen ein, hielt das gesamte Prozedere für etwas antiquiert, konnte und wollte sich aber nicht davon ausschließen.
In einer wohltuenden Distanz beschrieb er die Variationsbreite der Reaktion der Aufnahme in diesen exklusiven Kreis. Manche konnten es beim ersten Mal kaum abwarten, vor dem Eingang zur Kantine für die Normalsterblichen nach rechts abzubiegen, in das kleine ersehnte Paradies. Dabei achteten sie darauf, dass sie von möglichst vielen gesehen werden, wenn sie zum ersten Mal dort eingelassen wurden. Ihm selber ist dies eher peinlich gewesen und er hat darauf geachtet, dass bei seinen ersten Besuchen ins Kasino der Leitenden möglichst wenig Verkehr auf dem Weg dorthin herrschte. Dass der von ihm so empfundene Widerspruch nicht geheuchelt war, weil er gerade einen Begleiter mit einem sozialwissenschaftlichen Stallgeruch bei sich hatte, zeigte sein Verhalten als junger Abteilungsleiter im Arbeitsalltag. Er ließ die Türe zu seinem Büro offen, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die Kolleginnen und Kollegen unmittelbaren Zugang zu ihm hatten. Für jemanden, der seinen Arbeitsplatz in einer sozial- bzw. geisteswissenschaftlichen Fakultät hat, wäre so etwas nicht besonders erwähnenswert, wohl aber in diesem Unternehmen. Dort war die Funktion eines Abteilungsleiters auch mit einer besonderen räumlichen und personellen Ausstattung verbunden. Er bekam ein größeres Büro mit drei oder vier Fenstern und ein Vorzimmer, das mit einer Sekretärin besetzt war. Sie regelte den Zugang zu ihrem Chef und verfügte dabei über eine nicht unbeträchtliche Variantenvielfalt der Ausgestaltung ihrer Rolle: von einem Zerberus bis zur Mutter Theresa.
Insofern musste ein direkter Zugang zu dem jungen Chef sie einer zentralen Funktion und damit ihrer geliehenen Macht berauben. Zwangsläufig war damit auch die Befürchtung verbunden, wie ihre Kolleginnen aus den anderen Vorzimmern ihre Degradierung wahrnehmen würden. Dazu kommt noch die Sorge der älteren Abteilungsleiterkollegen, denen das neue Verhalten des jungen Abteilungsleiters als eine Kulturrevolution erscheinen muss, die das gesamte hierarchische System, in dem man sich erfolgreich behauptet hat, ins Wanken gerät. Und wenn dieser junge Kerl dann mehrmals am Tage sein Büro verlässt, nicht wegen einer schwachen Blase, sondern weil er sein Team an deren Arbeitsplatz aufsucht, gehört sich dies nicht. Ein Abteilungsleiter lässt seine Leute zu sich kommen, er muss sie ja nicht unbedingt „antanzen lassen“, da haben einen die eigenen Kinder schon etwas erzogen, aber der Weg zu ihm soll ihnen immer wieder zu erkennen geben, wer hier der Chef ist.
Unabhängig von der individuellen Balanceleistung, die die Mitglieder einer Organisation tagtäglich erbringen müssen, bleibt grundsätzlich festzustellen: Das Verhältnis zwischen Organisation und Individuum ist von einer gegenseitigen Abhängigkeit geprägt. Die Organisation braucht Menschen, die in und für sie handeln und die Menschen brauchen die Organisation um mit deren Hilfe in einer sozialen Gemeinschaft handlungsfähig zu sein. Beide behindern sich zugleich auch. Die Menschen die Organisation durch ihren Eigennutz, und die Organisation die Individuen als Schranken der freien Entfaltung. In diesem Spannungsfeld findet politisches Handeln i.S. von Mikropolitik statt. Unter diesem Begriff sind Prozesse der Auseinandersetzung zwischen Individuen und der Organisation seit den 70er Jahren Gegenstand der Wissenschaft in den USA geworden und Anfang der 80er Jahre durch Horst Bosetzky in Deutschland unter dem Begriff Mikropolitik zu einem organisationstheoretischen Thema geworden. Oswald Neuberger hat die damit verbundenen Fragestellungen inzwischen zu einem seiner Arbeitsschwerpunkte gemacht.
Mikropolitik ist geprägt durch Dichotomien von zwei Herausforderungen im Abgleich zwischen Organisation und Individuum, die in einem Widerspruch zueinander stehen, sich aber gegenseitig brauchen. Dazu gehören
- Freiheit vs. Zwang,
- Konsens vs. Kontrolle,
- Autonomie vs. Abhängigkeit
Innerhalb dieser Spannungsverhältnisse, die von Crozier und Friedberg als Unsicherheitszonen bezeichnet werden können, liegt das Potenzial bzw. der Handlungsraum für Einflussnahme durch die Organisationsmitglieder. Deren Handeln ist nicht primär durch die Organisationsziele bestimmt, sondern, vor allem in Unternehmen, primär durch existenzsichernde Motive und schließlich auch durch andere Beweggründe, die wir in der Maslow‘schen Bedürfnispyramide auf den weiter oben liegenden Stufen der Anerkennung und der Selbstverwirklichung angesiedelt sehen können. Dabei geht es also um die Erfüllung des Wunsches nach Ansehen, Prestige, Wertschätzung, Stärke und Erfolg, den nur andere uns in sozialen Beziehungen erfüllen können und schließlich auch um das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit.
Allerdings, Mikropolitik ist nicht nur darauf aus, die eigenen egoistischen Vorteile zum eigenen Fortkommen oder wenigstens zur Absicherung der wirtschaftlichen Existenz herzustellen, sondern beinhaltet auch allgemeine, über die eigenen existenzsichernden Interessen hinausgehende Vorstellungen über die Gesamtorganisation. Dies vor dem Hintergrund der eigenen Vorstellungen von Abläufen und zugleich vor dem Hintergrund der Gerechtigkeit und der Transparenz und damit auch, um Vorgänge in einer Organisation nachvollziehbar und für den Einzelnen begreifbar zu machen.
Aus eigenen Erfahrungen in den unterschiedlichsten Berufsfeldern als Werkstudent oder später als Organisationsentwickler konnte ich feststellen, dass sich die einzelnen Mitarbeiter über ihre eigenen Tätigkeiten hinaus Gedanken über die Arbeitsvollzüge generell machen. Ob es der eigene Arbeitsplatz, die gesamte Meisterei oder die Nachbarabteilung war, sie waren dem kritischen Blick der Mitarbeiter ausgesetzt. Dabei wurde nicht nur beäugt, was dort anscheinend schiefläuft, sondern auch Vorschläge gemacht, wie sie es selbst handhaben würden, wenn sie etwas zu sagen hätten. Selbst die Ebene des Topmanagements wird dabei nicht ausgelassen. Als Motive für solch ein Denken kann man einerseits das Interesse an dem Unternehmen vermuten, das über das aktuelle Interesse des Einzelnen hinausreicht. Dennoch ist es nicht frei von Egoismen. Zum einen mag die Kritik an den Abläufen in anderen Abteilungen als Versuch dienen, die Schuldigen außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs zu suchen. Hinzu kommt noch das Bedürfnis nach Transparenz in den Abläufen, das umso größer wird, je komplexer das Unternehmen ist. Und dahinter schließlich verbirgt sich ein grundlegendes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Feststellen zu können, ob andere nicht besser behandelt werden als man selber, verlangt nach einem Einblick in deren Sphäre.
Das Spannungsverhältnis zwischen Organisation und dem Individuum mit ihren z.T. unterschiedlichen Interessen und Zielsetzungen wurde mir während meiner ersten Arbeiten an diesem Kapitel durch ein Ereignis bewusst, das ich selber mit großem Interesse verfolgte. Es war die Fußballeuropameisterschaft im Juni und Juli 2016. Konkret waren es die Kommentare, die die Fußballhelden zu ihren eigenen Leistungen und denen der gesamten Mannschaft abgaben. Beispielhaft sei hier auf die Verarbeitung des Tores von Xherdan Shaqiri im Achtelfinalspiel Polen – Schweiz verwiesen. Sein Traumtor, eine Mischung aus Seitfallzieher und Fallrückzieher zum zwischenzeitlichen Ausgleich, war wirklich eine Augenweide, unabhängig davon, für welche der Nationalmannschaften man die Daumen drückte. Später vom Reporter auf die Bewertung seines Tores angesichts der Niederlage seines Teams angesprochen, musste der arme Held zwangsläufig lügen und behaupten, wichtiger wäre es gewesen, wenn die Mannschaft gesiegt hätte und er sich noch besser in den Dienst der Mannschaft hätte stellen können. Wenn man die überflüssige, nicht mal unbedingt rhetorische Frage berücksichtigt, kann man die Antworten des Fußballers als Reflex auf den Unsinn dieser Frage verstehen Herrn Shaqiri lediglich einer Notlüge bezichtigen. Natürlich musste es ihm bewusst sein, dass das von ihm erzielte Jahrhunderttor seinen eigenen Marktwert erheblich steigern würde und selbst, wenn dieser irgendwann wieder fällt, hallt ihm der Nachruf noch über Jahre oder Jahrzehnte nach, wenn dieses „Jahrhundert-Tor“ dann bei irgendeinem Fußballwettbewerb zum tausendsten Mal gezeigt wird. Doch die Einbindung in die Ideologie, die mit dem Begriff Mannschaftssport getrieben wird, ließ keine ehrliche Antwort zu, wenn er sich nicht in Gefahr bringen wollte, einen Teil seines gestiegenen Marktwertes sofort wieder zu verspielen. Allerdings konnte sich der Torschütze insgeheim freuen, dass sein staatstragendes Verhalten nie in Konkurrenz zu dem Wert seines Kunstschusses geraten wird, zumal sein Torerfolg ja auch mit dem Teamziel eines Sieges nicht kollidierte. Insofern kann man die Antwort von Shaqiri als eine politische verstehen, vorausgesetzt man versteht politisch als Kennzeichen eines bestimmten Verhaltens, das man auch als diplomatisch, klug, zweckmäßig, schlau oder listig definieren könnte, wie es schon im Mittelalter der Fall war.
Diese Kennzeichnung aus dem Mittelalter stimmt zu einem großen Teil auch mit dem Begriff des Strippenziehers überein, der in der Lage ist, Mikropolitik zu seinem eigenen Vorteil mit zu betreiben. Der Erfolg des Strippenziehers hängt dabei von seinem Geschick ab, vor allem auf der Beziehungsebene Verbindungen und Abhängigkeiten herzustellen. Man tut sich jeweils einen Gefallen im Sinne eines Tauschgeschäftes, man bildet einen kleinen Markt des Austausches von Gefälligkeiten, wobei auch ein Schuldschein oder ein Wechsel akzeptiert wird, der erst später zur Einlösung ansteht. Nur mit einem solchen Vorverständnis wird deutlich, was damit gemeint ist, wenn auf die Frage, ob eine bestimmte Entscheidung sachlich gerechtfertigt sei, die Antwort folgt: Das wäre eine politische Entscheidung gewesen. Politisch muss demnach als Gegenpol zur Sachlichkeit erscheinen. Insofern erscheint das Eisbergmodell angebracht zu sein, das in der Kommunikation lediglich ein Siebtel der Prozesse an der Oberfläche (auf der Sachebene) ablaufen sieht, während sechs Siebtel unter der Wasserlinie im Verborgenen, also auf der Beziehungsebene, stattfinden. Und Politik ist im Wesentlichen Kommunikation.
Ziel der Mikropolitik ist also die Gestaltung des „Gemeinwesens“ Organisation, zunächst unter zwei zentralen Gesichtspunkten, und zwar
- Der Erfüllung des Organisationszieles nach außen
- Der Befriedigung der Bedürfnisse bzw. der Interessen der Organisationsmitglieder
Dazu gehört nun schließlich noch ein Drittes, und zwar
- Der Erhalt der Organisation selbst
Wem es gelingt, seine individuellen Ziele mit denen der Organisation zusammenzubringen, hat Einfluss. Dies zu erreichen, erfordert von dem Individuum zum Akteur zu werden und Handlungsorientierung zu zeigen. Insofern wird die Akteursperspektive unter der Maxime der Handlungsorientierung im Zentrum der weiteren Diskussion des Verhältnisses von Individuum und Organisation stehen.
In einer Organisation als Akteur aktiv zu sein, ist schon vom Begriff her mit Handlung verbunden. Zwar kann auch ein Nicht-Handeln eine Form der Einflussnahme darstellen, aber nur, wenn dies bewusst erfolgt und auch als solches für andere erkennbar ist, denn sonst macht dies keinen Eindruck und verliert dadurch die Wirkkraft. Wenn jemand nichts tut, weil er mit einer Angelegenheit nicht befasst ist, kann man einem solchen Nicht-Verhalten keinen Einfluss zusprechen. Wenn jemand allerdings nichts tut, obwohl er unmittelbar von einer Angelegenheit betroffen ist und vor allem auch dann, wenn er zuvor mehrmals bewusst eingegriffen hat, hat dies Wirkung auf andere. In dem Spannungsverhältnis zur Macht der Organisation ist der Mensch Mittel, hat aber auch die Mittel, sich gegen eine totale Vereinnahmung zur Wehr zu setzen. Dabei vergrößerte gerade die zunehmende Komplexität in den Entscheidungsvorgängen, innerhalb und zwischen den Institutionen, die Chance der Freiheit des individuellen Handelns. Dies liegt zu einem großen Teil auch in den oben benannten Unsicherheitszonen. Alles, was nicht klar geregelt ist und dadurch Unsicherheit ausstrahlt, reizt Menschen, Klarheit zu verschaffen und dies wiederum erreicht man nur durch aktives Handeln und Handeln wiederum schafft neue Situationen. Darin schließlich liegt das Potenzial für eine wirkungsvolle Einflussnahme.
Wenn diejenigen, die von einer Aktion angenehm oder unangenehm betroffen sind, das Geschehen einschätzen sollen, gehen sie häufig von der Vorstellung aus, dass der Akteur einem klaren Plan folgt bzw. folgte. Im Nachhinein mag eine solche Interpretation naheliegen, vielleicht sogar auch für den Akteur selbst. Ob diese Interpretation zutrifft, darf allerdings bezweifelt werden. Ich kann mir aber nur schwer vorstellen, dass sich Menschen in ihrem Alltag zu Hause an den Küchentisch setzen, den Kopf in die Hände stützen und angestrengt nachdenken, wie sie auf ein Ziel vorgehen. Wenn ein konkretes Problem ansteht, mag dies so sein, um kurzfristig eine Lösung zu finden, aber nicht, wenn es um die Strategie für die Erreichung eines Langfristzieles geht. Da wird häufig aus dem Bauch heraus gehandelt und die getroffenen Entscheidungen später auf das Ziel hin justiert.
Anders ist es, wenn Organisationen und vor allem Unternehmen als ein kollektiv handelndes Subjekt auftreten. Dort ist die bewusste Entwicklung von Strategien unerlässlich, wenn man die Mitakteure innerhalb der Organisation zu einem gemeinsamen Handeln bringen will. Nur so kann das Ziel des Unternehmens erreicht werden. Wenn jeder in eine andere Richtung rudert, kommt das Unternehmensschiff wohl kaum ins Ziel, sondern eher ins Schlingern. Allerdings kann man nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass jeder seinen Beitrag mit der gleichen Kraft und derselben Begeisterung leistet, wie von der Schiffsführung gewünscht. Unabdingbare Voraussetzung allerdings ist, dass er seine Ruderblätter nicht in die Gegenrichtung lenkt.
Dass es nicht leicht ist, solch ein Unternehmen auf Kurs zu halten, zeigen die unzähligen Managementmaßnahmen, die initiiert werden, und die Heerscharen an Unternehmensberatern, die eingekauft werden. Ihre Aufgabe besteht zum einen darin, bei der Formulierung von Strategien Unterstützung zu leisten und in einem zweiten Schritt, Prozesse zu begleiten, diese Strategien in das Unternehmen so hineinzuarbeiten, dass „unten“ oder „an der Front“ das möglichst unverfälscht herauskommt, was „oben“ gedacht wurde. Die Implementierung der Strategien in das Unternehmen hinein hat zum einen die Funktion der gezielten Kommunikation, zum anderen aber auch der Verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Maßnahmenpaket hin, das von der Unternehmensleitung beschlossen und von den jeweiligen Vorgesetzten der darunterliegenden Ebenen in deren Aufgaben heruntergebrochen oder sagen wir besser: konkretisiert wird.
Im Folgenden werden einige Strategien beschrieben, die einen dabei unterstützen, den eigenen Einfluss im wahrsten Sinn des Wortes zu mehren, indem man z.B. auf der Beziehungsebene „arbeitet“ oder sich ganz einfach um Verbündete bemüht, die einem mehr Gewicht verleihen. Gewissermaßen als Marker wird das Bemühen um Verbündete vom Autor mit dem Begriff „Matroschka-Prinzip“ versehen und im Text dann auch näher erläutert.
Andere für sich persönlich gewinnen
Die anderen für sich gewinnen ist eine Grundtaktik, die weniger auf der Sachebene zu verorten ist, als vielmehr auf der Beziehungsebene. Andere werden nicht aufgrund ihrer Überzeugung mit einer Sache bzw. mit meinem Plan, eine Sachfrage zu lösen, angesprochen, sondern auf der Ebene, mir einen persönlichen Gefallen zu tun. Die Vielfalt der Varianten ist groß, angefangen von einem Betören bis hin zur Erpressung, von einem erotisch behauchten Flirt zwischen den Geschlechtern über das nachdrückliche Mahnen daran, dass man dem anderen selbst schon einmal eine Gefälligkeit getan habe, bis hin zur Erpressung, indem man dem anderen empfindliche Sanktionen andeutet. Grundvoraussetzung für das Funktionieren dieser Taktik, ist allerdings, dass dem anderen daran liegt, sich mit mir auf der Beziehungsebene gut zu stellen oder diese wenigstens nicht zu belasten. Ein kleinster gemeinsamer Nenner wird dann gefunden, wenn der andere meiner Meinung beitritt, um sich nicht weiter genervt zu fühlen. Diese letzte Taktik, die Kleinkinder schon früh im Rahmen der Supermarktsozialisation wirksam einsetzen, verfehlt auch im Erwachsenenalter ihre Wirkung nicht.
Eine weitere Taktik liegt darin, den anderen zu hofieren und aus dessen so stilisierter Überlegenheit um Unterstützung zu ersuchen. Konkrete Formen können in folgenden Killerphrasen ihren Ausdruck finden. „Sie sind der einzige, der mir gegenwärtig helfen kann“ oder „Aufgrund ihres Einflusses, müsste es ihnen doch möglich sein, mir zu helfen“. Eine andere Variante ist, den anderen zu seinem Retter hochzustilisieren, innerhalb des bekannten Drama-Dreiecks „Retter, Verfolger und Opfer“. Die wohl erfolgreichste Variante jemanden für sich einzunehmen, ist generell die, einen gemeinsamen Feind zu finden bzw. aufzubauen, gegen den es gilt zusammenzustehen. Darüber hinaus ist eine Vielfalt von Inszenierungen denkbar, die bei meinem Gegenüber Reflexe eines Beschützers auslösen. In der Terminologie der Transaktionsanalyse formuliert, könnte man auch das angepasste Kind spielen, das eine parallele Transaktion zu einem fürsorglichen Eltern-Ich aufbaut, in dem Sinne „Papa, ich brauche hier nochmals deine Hilfe. Alleine schaffe ich es nicht!“. Man müsste schon als 70-jähriger Pensionär sehr abgebrüht sein, seinem 40-jährigen Sohn, obwohl er inzwischen ein ansonsten erfolgreicher Manager ist, wieder einmal aus der Patsche zu helfen.
Schließlich hat auch ein augenzwinkerndes, charmant verpacktes Geständnis: „Ich weiß, es ist zwar nicht ganz so fein, dich hier um deine Stimme zu bitten, doch könntest du nicht dieses oder jenes für mich tun, oder dich wenigstens auf meine Seite stellen?“
Zentraler Schlüssel, um jemanden für sich auf der Beziehungsebene zu gewinnen, ist, ihm seine Wertschätzung zu zeigen.
Das Matroschka-Modell, das gängige Grundprinzip, Verstärkung zu holen und Mehrheiten zustande bringen
Die wohl häufigste Art in und vor allem durch Organisationen, Einfluss zu nehmen, ist die, sich mit anderen zusammenzutun, um innerhalb demokratischer Entscheidungsprozesse eine Mehrheit oder zumindest eine respektable Anzahl Gleichgesinnter zusammenzubringen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, möchte ich als Matroschka-Prinzip bezeichnen.
Matroschka sind kleine, bunt bemalte, eiförmige, russische Holzpuppen, die ineinander schachtelbar sind. Als Spielzeuge und vor allem als Souvenir erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Sie gibt es sowohl in der ursprünglichen weiblichen Variante wie der Wortstamm mater (Mutter) verdeutlicht, aber auch in der kriegerisch männlichen. Je nach Bemalung kann die Symbolik wechseln, von volkstümlichen Mutterfiguren bis hin zur satirischen Wiedergabe von Politikern. Die Figurensätze können mehr als 20-teilig sein. Zum Teil wird diesen Gebilden auch eine Talisman-Wirkung zugesprochen.
Gerade die Verschachtelung, die den kleineren Puppen einen wachsenden Umfang verleiht, indem sie jeweils in der nächst größeren aufgeht, ist für mich der eigentliche Anreiz mit diesem bildhaften Begriff zu hantieren. Sie kann einen Prozess der bewusst herbeigeführten Vergrößerung der eigenen Einflusschancen verdeutlichen, den ich in allen Organisationsformen beobachten und vor allem im Rahmen der Lobbyarbeit selbst biographisch einprägsam erfahren konnte. Dazu kann ich vor allem auf meine Tätigkeit als Geschäftsführender Pädagogischer Leiter des niedersächsischen Landesverbandes der Heimvolkshochschulen verweisen.
Fügen wir beispielhaft einen Puppensatz zusammen, so wie ich es in meiner damaligen Funktion selbst erlebt habe. Als kleinste Puppe wählen wir exemplarisch die gewerkschaftlich und sozialdemokratisch orientierte Heimvolkshochschule Springe, 30 km von meinem damaligen Arbeitsplatz in Hannover entfernt. Um für ihre Belange als Heimvolkshochschule zu kämpfen, die sich von den anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen, die überwiegend „ambulant“ arbeiten, durch die „stationäre“ Unterbringung von Teilnehmern für eine längere Zeit (von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten) unterscheiden, schließen sie sich mit den anderen 14 Einrichtungen zusammen, die in der gleichen Veranstaltungsform, von den Inhalten zunächst abgesehen, arbeiten. Der Zusammenschluss der 15 HVHSn stellt sie zweite, schon etwas größere Puppe dar, die der einzelnen Einrichtung in der Behauptung ihrer Interessen mehr Gewicht verleiht. Diese Organisation wiederum ist Mitglied eines Dachverbandes, in dem alle anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen mit ihren Lobbyorganisationen zusammengefasst sind, also die Volkshochschulen, die gewerkschaftlich orientierte Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben, die Evangelische Erwachsenbildung, die Katholische, das Bildungswerk der DAG, die Ländliche EB und alle, die später noch hinzukamen. Dieser Dachverband hatte primär die Aufgabe, den Interessen aller Erwachsenenbildungseinrichtungen in Niedersachsen Geltung zu verleihen und vor allem für ein ausreichendes Stück aus dem öffentlichen Finanzkuchen zu sorgen. Diese dritte Puppe mit dem Namen „Erwachsenenbildung“ wiederum konnte sich darum bemühen, Platz und aber auch Stimme in der nächst größeren Puppe zu erhalten, die man wohl am besten mit dem „Bildungssektor allgemein“ bezeichnen könnte.
Wenn wir nun aber ein anderes Label als die Veranstaltungsform „Heim“ wählen und die Ziele und Inhalte in den Fokus nehmen, stellt sich das Puppenensemble wiederum neu dar. Die gewerkschaftliche und sozialdemokratische Orientierung lässt die HVHS Springe dann eher die Nähe zu gewerkschaftlich orientierten Erwachsenenbildungsorganisation „Arbeit und Leben“ mit ihren ambulanten Maßnahmen suchen und nicht die zu einer evangelisch, ländlichen Heimvolkshochschule, wie sie z.B. in Loccum oder Rastede zu Hause ist und hinsichtlich der inhaltlichen Orientierung eher der „Evangelischen Erwachsenenbildung“ oder der „Ländlichen Erwachsenenbildung“ zuzuordnen ist. An diesen Beispielen wird die Komplexität der Lobbyarbeit deutlich und verlangt von denen, die auf einer solchen Bühne spielen, ein Maß an Kunstfertigkeit, die Balance zwischen den unterschiedlichen Puppenkonstellationen zu finden.
Eines muss allerdings von vornherein bedacht werden. Lobbyarbeit besteht nicht nur darin, sich zu anderen Puppendimensionen aufzuplustern, sondern muss auch bedenken, dass die Puppen schließlich wieder voneinander getrennt werden müssen. Dieses ist spätestens dann notwendig, wenn es darum geht den durch Größe ausgehandelten größeren Finanz-Kuchen wieder untereinander aufzuteilen. Es wäre also gefährlich, sich in den nächst größeren Puppen ganz aufzulösen. Vielmehr muss man für die Unversehrtheit der eigenen Hülle Sorge tragen. Den Matroschka wird von der Grundsymbolik her eine gewisse Talisman Wirkung zugesprochen. Ob sie tatsächlich Glücksbringer sein können, hängt von der Kunst ab, die Bündelung der Kräfte zusammen mit anderen Betroffenen und den Erhalt der Selbstständigkeit in Einklang zu bringen.
Das Grundprinzip der Matroschka, verdeutlicht die Vergrößerung der Machfülle über die größer werdende äußere Hülle. Eine andere Frage ist, um im Bild zu bleiben, welche Puppen überhaupt zusammenpassen.
Das in Organisationen dauerhaft zu spürende Spannungsverhältnis zwischen den Individualinteressen einerseits und zwischen diesem und dem gesamten Organisationsziel andererseits, kann über ein zentrales Faktum nicht hinwegtäuschen, das die Organisationssoziologie als ein allenthalben zu beobachtendes Phänomen festgestellt hat. Es ist der Selbsterhalt der Organisation selbst. Es mag genügend Begründungen für dieses Phänomen geben, sie sollen hier jedoch nicht weiterverfolgt werden. Vorrangig soll im Zusammenhang mit der Fragestellung des vorliegenden Buches die Tatsache mitbedacht werden, dass mit einem dritten Ziel, also dem Selbsterhalt der Organisation, die Komplexität des mikropolitischen Handelns nicht kleiner geworden ist. Dies liegt zu einem gewissen Grade auch daran, dass das Ziel des Organisationserhaltes jeweils auch Schnittmengen zu den anderen beiden Zielen bildet. Die Komplexität entbindet jedoch nicht von der Notwendigkeit des Handelns. Unter welchen Bedingungen dieses Handeln sowohl betrachtet als auch gestaltet werden kann, soll in dem nachfolgenden Kapitel entfaltet werden.
Bedingungen des mikropolitischen Handelns
Politisches Handeln, mit welchem Mittel wir es vorantreiben, ob durch autoritäre Vorgaben, ob durch ein einschmeichelndes Überreden oder ein politisches Handeln, eines muss dem Akteur bewusst sein: Sein Agieren findet nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern unter einer bestimmten Anzahl von Bedingungen. Oswald Neuberger definiert Merkmale des Politischen. Es sind Eigenschaften, die politisches Agieren ausmachen. Sie können uns als Merkposten dienen, politisches Handeln sowohl zu analysieren als auch als Orientierungen, für die Ausgestaltung der eigenen Rolle als Akteur.
- Interessen (Warum oder wozu handelt jemand?)
- Intersubjektivität (Welche interpersonellen Beziehungen bestehen und wie werden diese genutzt?)
- Legitimation (Wie werden Handlungen oder Verhältnisse gerechtfertigt?)
- Macht (Wie wird das Geschehen beherrscht oder kontrolliert?)
- Dialektik der Interdependenz (Wie wird wechselseitige Abhängigkeit bewältigt?)
- Mehrdeutigkeit (Welche Mehrdeutigkeiten, Widersprüche und Interdependenzen erlauben/erfordern „interessiertes Handeln“?)
- Zeitlichkeit (Wie wird Wandel umgegangen und das Timing gestaltet?)[4]
Einige dieser hier benannten Aspekte werden im Folgenden in Ausschnitten näher beschrieben
Macht und Interdependenz
(Wie wird wechselseitige Abhängigkeit bewältigt und produktiv genutzt?)
Die Aspekte Macht und Interdependenz werden zusammen diskutiert, zumal sie in Organisationen und insbesondere in den Willensbildungsprozessen in einem wechselseitigen Verhältnis zueinanderstehen. Insbesondere der Aspekt Macht erfährt durch die Interdependenz auch zu „Untergebenen“ eine nicht zu unterschätzende Einschränkung. Macht funktioniert nur uneingeschränkt, wenn sie sie akzeptiert wird. Die Akzeptanz wiederum ist Voraussetzung dafür, dass das, was der Machtträger erreichen möchte, auch tatsächlich umgesetzt wird. Findet der Umsetzungsprozess nicht statt oder erscheint er als schlechte Kopie des Gewollten, wird ein Machtgebaren eher zur Karikatur.
Zuvor noch eine begriffliche Klarstellung:
Macht besteht darin, einem anderen etwas gewähren oder verwehren zu können, einen anderen mit Sanktionen zu belegen. Sie ist primär einem Individuum zugeschrieben wird im übertragenen Sinne begrifflich auch für Organisationen und Strukturen verwendet.
Herrschaft ist strukturell definiert als Gesamtsystem, das Machtfunktionen schafft und die Inhaber solcher Funktionen mit einer solchen Macht ausstattet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Herrschaftssystem der Macht der Individuen vorausgeht. Es ist ebenso möglich, dass Machtinhaber zur Legitimation und Absicherung gleichermaßen um sich herum ein entsprechendes System aufbauen.
Macht und Herrschaft sind allerdings keine Steigerungsformen von Einfluss. Wer Macht auf andere ausübt, verfügt über bessere Mittel, seine Ideen durchzusetzen, aber dies ist noch keine Garantie dafür, dass diese Idee tatsächlich auch so umgesetzt wird, wie intendiert. Es gibt so viele Möglichkeiten der Gegenwehr oder wenigstens der Verwässerung einer Idee, wenn die, die für die Umsetzung die Verantwortung tragen, nicht überzeugt sind. Insofern ist erst die Addition von Macht und Einfluss die Voraussetzung für die Realisierung einer Idee.
Der Bedeutung und der Wirkung von Macht kann man nur gerecht werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Interdependenz betrachtet wird, also der gegenseitigen Abhängigkeit zwischen dem, der Macht ausübt bzw. ausüben möchte und dem, der ihr ausgesetzt ist bzw. werden soll. Ohne dass sich der eine der Macht beugt, die der andere ausübt, verliert Macht an Wirkung. Wie verzweifelt sind die Mächtigen, wenn sie feststellen müssen, dass die Abhängigen das nicht tun, was sie befehlen. Folter und andere Grausamkeiten sind im Grunde genommen Ausfluss der erfahrenen Ohnmacht der Mächtigen.
Es gehört nach existenzial-phänomenologischer Auffassung zur menschlichen Daseinsweise, dass wir uns immer im Verhältnis zu anderen Menschen befinden. Dem dänischen Philosophen und Theologen Knud Eiler Løgstrup zufolge sind alle diese Relationen geprägt von Interdependenz, gegenseitiger Abhängigkeit, d. h. dass alle menschlichen Relationen das gegenseitige Ausüben von Macht beinhalten. Die elementare Form von Macht kann die Macht der persönlichen Verhältnisse genannt werden. Auf der grundlegenden Ebene besteht Interdependenz darin, dass wir uns zu anderen Menschen nicht persönlich verhalten können – mit Ihnen kommunizieren, mit ihnen umgehen –, ohne uns auszuliefern. Sich an einen anderen zu wenden, ihn anzusprechen, schließt die Erwartung ein, von dem anderen ernst genommen zu werden und Antworten zu erhalten. Eine solche Erwartung ist eine Entblößung, eine Selbstauslieferung. Und in der Selbstauslieferung des Einen liegt die Macht des Anderen.
Bezogen auf das Einwirken auf andere, wird Macht ohne Akzeptanz auch ohne Einfluss bleiben. Wenn der Begriff Einfluss bildlich verdeutlichen will, mit Absicht und der Wirkung etwas in das einfließen zu lassen, was schon fließt, erhöht Macht lediglich die Durchflussgeschwindigkeit; die Auswirkung auf das, was hier fließt, ist dadurch aber nicht gesichert. Das, was der Machtträger an Ideen, an Motivation, an Kraft seiner Absicht beimengen will, kann er allein mit Macht nicht erreichen.
Hier gilt gleichermaßen mein Grundcredo für die Führungsarbeit. Wer als Führungskraft auf seine Machtposition pochen muss, hat schon verloren. Die hierarchische Position garantiert der Führungskraft die Befugnis eine Sache anzustoßen und die Initiative zu ergreifen. Wenn ich meine Mitarbeiter nicht überzeugen kann, werden diese jede Möglichkeit ersinnen, den Beweis zu erbringen, dass mein angewiesener Plan nicht funktionieren kann. Insofern gibt es keine Macht ohne gleichzeitige Abhängigkeit von dem, gegen den die Macht gerichtet ist.
Man braucht nicht unbedingt sozialpsychologische Erkenntnisse oder literarische Vorbilder heranziehen, die aufzeigen, wie der Herr den Diener braucht und umgekehrt der Diener den Herrn. Dies kann in einer Art und Weise geschehen, dass der Knecht zum eigentlichen Herrn wird. Zumindest kann Macht eine Gegenmacht derer auslösen, die eigentlich gar nicht so ohnmächtig sind. Wenn der Hierarch Lohn, oder Anerkennung verweigert, kann der Mitarbeiter gute Arbeit, Engagement und konstruktive Ideen verweigern. Beide können sich notwendiger Ressourcen berauben. Schließlich gibt es als einen letzten Ausweg noch die Möglichkeit, eigene Ohnmacht so zur Schau stellen, dass dem Mächtigeren, wenn er nicht als gefühllos erscheinen mag, nichts anderes übrigbleibt, als zu helfen. Dies ist eine Taktik, die eher im privaten Kontext zu Hause ist. In professionellen Situationen funktionieren Augenaufschlag und Kindlichkeitsschemen weniger.
Eigene Erfahrungen mit den Möglichkeiten, eine Gegenmacht aufzubauen gegenüber denjenigen, deren Ressourcen ich brauchte, konnte ich kaum machen. Diejenigen, deren Ressourcen ich sowohl bei meiner Tätigkeit in der Erwachsenenbildung als auch später an der Universität brauchte, waren öffentliche Finanzmittel. Eine mögliche Drohung, bei nicht ausreichender Förderung der Erwachsenenbildung diese einzustellen, hätte im politischen Alltagsgeschäft wohl kaum eine Wirkung gezeigt. Dasselbe konnte man auch bei den Streikbemühungen konstatieren, die Studierende aus hochschulpolitischen Gründen in den 70er Jahren mehrmals anstellten. Ob Diplomstudenten der Fachrichtung Erwachsenenbildung für einige Wochen keine Lehrveranstaltungen besuchen, wird weder die Einrichtungen der Erwachsenenbildung aufschrecken lassen noch die Erwachsenen selbst. Wenn solche Aktionen überhaupt einen Sinn machten, so dienten sie eher der Selbstmotivation der Studierenden und der Solidarisierung. Den Aktivisten unter den Studierenden boten sie zudem ein Übungsfeld für die Initiierung von sozialen Prozessen, die ihnen später als Trainer und Organisationsentwickler durchaus weiterhalfen. Verglichen mit den Auseinandersetzungen z.B. zwischen VW und einem Zulieferer, die in der Zeit stattfanden, als das Manuskript für dieses Buch entstand, waren die studentischen Streiks von geradezu marginaler Bedeutung.
Wenn die Unruhe an den Universitäten dennoch eine Wirkung hatte und Proteste der Erwachsenenbildungseinrichtungen solche hätten haben können, dann nicht wirklich aus einer akuten Bedrohungslage, sondern aus einem weniger gewichtigen, dennoch aber nicht zu vernachlässigendem Grund. Welcher Minister möchte in seinem Verantwortungsbereich Unruhe? Der mögliche Vorwurf, sein Revier nicht richtig im Griff zu haben, ist einer politischen Karriere nicht gerade dienlich. Durch solch schlichte Mechanismen wird häufig politisches Denken und Handeln beeinflusst.
Macht und Machtstrukturen sollen hier keineswegs als Teufelszeugs gebrandmarkt werden. Sie sind insgesamt nötig, um Verantwortlichkeiten zu deklarieren und auch Vorgänge zu beschleunigen. In der Führungstheorie wird dies u.a. als ‚Management by Exception‘ bezeichnet. Es gibt eben Fälle, in denen ein Machtwort nötig ist. Zudem ist der Glaube an die Bedeutung der formalen Macht auch die Triebfeder für Karriere, vor allem, wenn auch die Belohnung des Prestiges der Machtposition in der öffentlichen Wahrnehmung dazukommt. Von daher dient sie auch der Entwicklung von Engagement für die eigene Arbeit. Macht kann eigenes Handeln und den Einfluss befördern, z.T. aber auch erschweren, und zwar abhängig von der spezifischen Kultur, in der man sich bewegt. In dem Produktionsbereich eines Unternehmens, in dem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon aus Gründen der Qualitätssicherung vorgegebene Abläufe einhalten müssen, nutzt Macht. In der Bildungsabteilung (mit Ausnahme der Ausbildung) wohl eher nicht. Genauso wie in der Universität, und dort vor allem bei den Sozialwissenschaften. Dort kann formale Macht auch ein Hindernis sein bzw. die Sache kompliziert machen. Vor allem bei Pädagogen, die nach dem Motto agieren: „Ich will auf den Einsatz meiner formalen Macht verzichten, erwarte aber dafür, dass ihr gerne das tut, was ich will“.
Meine sehr persönlichen und z.T. auch leidvollen Erfahrungen, die man in solchen Situationen mit Double-Bind-Charakter macht, veranlassen mich zu der Behauptung, dass es nicht hilft, um die Notwendigkeit eines Machtwortes in bestimmten Fällen herum zu taktieren, man muss es aussprechen und noch besser schon im Vorfeld darauf hinzuweisen, dass man den Anspruch aufrecht erhält, es gegebenenfalls zu tun. Man muss es ja nicht so taktlos anstellen, wie ich es einmal scherzhaft versucht habe. Es war schon spät am Abend und ich bat einen meiner Mitarbeiter, mir, bevor er nach Hause geht, eine bestimmte Unterlage auf den Schreibtisch zu legen. Als er mit einem ironischen Grinsen fragte, warum, antwortete ich: „Weil ich dein Chef bin“. Seine Replik, jetzt würde ich endlich mein wahres, autoritäres Gesicht zeigen, ließ nicht auf sich warten. Ich konnte mir darauf den Hinweis nicht verkneifen, dass mir eine kürzere Begründung so kurz vor Feierabend leider nicht eingefallen sei.
Ich denke, dieses Beispiel umfasst einen Großteil der Fassetten, die durch Macht unterstützte Führung heute hat. Wir sollten uns nicht auf die Grundfrage reduzieren, ob ein Einsatz von Macht richtig ist oder falsch, sondern uns auf die Ausgestaltung der uns verliehenen Macht konzentrieren. Die Palette reicht vom Despoten über die graue Eminenz, bis hin zur Mutter Theresa.
Die Machtfrage in Organisationen ist in ihrer praktischen Konsequenz schließlich zudem abhängig von den jeweiligen Inhalten, über die entschieden wird.
So ist innerhalb einer Universität mit präsidialer Verfassung der Präsident der Chef der Einrichtung. Er steht bei offiziellen Schreiben oben auf dem Briefkopf, und wer in der akademischen Selbstverwaltung, ob als Vorsitzender einer Kommission oder als Dekan, handelt, handelte im Auftrag des Präsidenten. In einem ebenso umfangreichen wie bedeutendem Feld der akademischen Verwaltungsarbeit war der eigentliche Herr der Kanzler, bzw. heute der Vizepräsident für Verwaltung und Finanzen. Wenn es z.B. um Haushaltsfragen ging, konnte man als Dekan zum Präsidenten gehen und sich Unterstützung erbitten, der eigentliche Verhandlungspartner war und blieb der Kanzler. Wenn man mit finanziellen Forderungen oder (realistischer ausgedrückt) Bitten zu ihm kam und er mit ernstem Blick zum Haushaltplan griff, konnte man erahnen, dass der Besuch bei dem Haushälter vergeblich oder zumindest unbequem wird. Auch wenn dies nicht ganz so deutlich und eher im Verborgenen blieb, waren die Machtverhältnisse in den einzelnen Fachbereichen vergleichbar.
Personelle Wechsel sind zugleich auch Anlässe für das Entstehen neuer Mehrdeutigkeiten. Mehrdeutigkeiten wiederum bieten die Chancen zu Interpretationen und zum Austausch der Interpretationen auch im Rahmen von faszinierenden Diskussionen, die einerseits von hohem inhaltlichem Gehalt, aber auch von rhetorischer Finesse sein können. All diese Chancen werden durch Prozesse verringert, die auf die Beseitigung der Mehrdeutigkeiten zugunsten von Eindeutigkeiten abzielen. Dennoch gibt es immer noch, selbst in dem festgezurrten Geflecht von Regelungen, genug Raum für Unstimmigkeiten und dieser bietet den Juristen ein Betätigungsfeld. Außerdem gibt es immer wieder Themen, die vor einem Potenzial an Mehrdeutigkeiten strotzen und es gibt immer wieder Personen, die in der Lage sind, solche aufzustöbern und sie für rhetorische gelungene Attacken zu nutzen und dadurch Einfluss zu nehmen, auch wenn sie faktisch über keine entsprechende Basis verfügen.
Ohne nun eine politische Nähe zu signalisieren, ist z.B. Gregor Gysi eine solche Persönlichkeit. Ohne seine Meinung teilen zu müssen, ist es doch immer wieder ein Genuss, ihm zuzuhören. Insofern plädiere ich für die Beibehaltung einer ausreichenden Menge von Mehrdeutigkeiten und vertraue auf eine zunehmende Ambiguitätstoleranz, die einflussreiches Handeln nicht auf ein Verwaltungshandeln reduziert und uns den Controllern unterwirft. Diese werden immer eine statistische Größe hervorzaubern, die eine Lösung suggerieren, die dann noch dem Stempel „alternativlos“ erhält und somit jegliche weitere nützliche Diskussion abwürgt, die gerade durch Mehrdeutigkeiten entfacht wird. Denn trotz aller Bemühungen, Mehrdeutigkeiten zu mindern oder durch klare Regelungen und Definitionen auszumerzen, bleibt immer ein Deut an Mehrdeutigkeit bestehen, so wie z.B. in dem empfundenen Unterschied zwischen formalem Recht und dem subjektiven Gerechtigkeitsempfinden, zwischen dem Beleg durch konkrete Zahlen und deren Vergleich und dem Gefühl, dennoch ungerecht behandelt worden zu sein.
Dies wird immer Anlass sein, zwischen Menschen eine neue Verständigung herbeizuführen, denn zwischen allgemeinen formalen Regelungen und der Berücksichtigung der besonderen Situation des Einzelfalles wird es immer eine Differenz geben. Leitlinie für die Parteien in einem solchen Verständigungsprozess werden letztendlich ethische Grundsätze bleiben und somit „Gegenstände“ der Legitimation. Damit ist auch die Grenze für die Akzeptanz „alternativer Fakten“ definiert, wie sie im dem Umfeld von Donald Trump verschleiernd und sarkastisch zugleich bezeichnet werden. Eine Lüge bleibt eine Lüge und ist ethisch verwerflich!
Den Austausch von Mehrdeutigkeiten und das Verhandeln über die größte Schnittmenge eines gemeinsamen Verständnisses, wird immer wieder aufs Neue erforderlich sein, denn zwischen allgemeinen formalen Regelungen und der Berücksichtigung der besonderen Situation des Einzelfalles, wird es immer eine Differenz geben. Leitlinie für die Parteien in einem solchen Verständigungsprozess werden letztendlich ethische Grundsätze bleiben und somit „Gegenstände“ der Legitimation.
Wenn ich unter dem Aspekt der Mehrdeutigkeit bislang grundsätzlich davon ausgegangen bin, dass diese nach einer Klärung verlangt, kann man die Mehrdeutigkeit durchaus auch als eigene Machtquelle benutzen. Man hält andere im Zustand der Unsicherheit, um nach eigenem Gutdünken jeweils Interpretationshilfe zu leisten, oder sogar zu entscheiden. Insofern erscheint mir die Mehrdeutigkeit im Rahmen der Einflussnahme eine der entscheidenden Faktoren. Sie ist eine zentrale Schaltstelle für Einfluss; entweder durch den Anspruch, das Verfahren zur Klärung zu beherrschen oder gerade umgekehrt, die Klärung zu behindern oder sogar zur weiteren Verschleierung beizutragen. Ziel dabei ist, jeweils situativ die Winkelzüge anzuwenden, nach eigenem Belieben und zum eigenen Nutzen Unklarheiten und Widersprüche aufzulösen. Dies ist die Spielwiese für Taktikfüchse, deren Erfolg nicht unwesentlich von ihrem rhetorischen Geschick abhängt. Insofern verdient der Aspekt der Mehrdeutigkeit eine besondere Aufmerksamkeit.
Die notwendige Wachsamkeit beim Umgang mit Mehrdeutigkeiten bedarf einer gründlichen Analyse hinsichtlich der Ursachen von Mehrdeutigkeiten. Karl Weick bietet hierbei eine äußerst nützliche Hilfestellung an, indem er folgenden Überblick über die Merkmale mehrdeutiger Situationen gibt[5], die von mir in Stichworten kommentiert werden.
Die Art des Problems ist unklar. Die Frage, „Was ist eigentlich dein Problem?“, und die Feststellung daraufhin, dass das eigentliche Problem, wenn man ein solches überhaupt hat, anders aussieht, ist ein eindeutiges Indiz für eine solche Unklarheit.
Die Informationen sind hinsichtlich der Menge und Zuverlässigkeit unzureichend. Die Folge ist, dass man sich mit Spekulationen aufreibt, oder jeder für sich nach Daten forscht, die seine schon vorab gebildete Meinung stützen.
Es zeichnen sich vielfältige, sich z.T. widersprechende Interpretationen ab. Das heißt, derselbe Vorgang, dieselbe Beobachtung, dieselben Fakten, werden unterschiedlich und z.T. unvereinbar interpretiert.
Unterschiedliche Wertorientierungen führen zu unterschiedlichen Bewertungen. Offiziell werden unterschiedliche Wertorientierungen wohl nicht diskutiert, oder vor allem von denen nicht zugegeben, die unsere Grundwerte nicht teilen. Wer gibt schon zu, nicht demokratisch handeln zu wollen. Insofern tauchen abweichende Werte in den verzweifelten Bemühungen auf, das eigene (im Grunde genommen undemokratische Verhalten) als demokratisch zu deklarieren.
Ziele sind unklar. So wie die mangelnde Klarheit hinsichtlich des eigentlichen Problems, führen unpräzise oder auch widersprüchliche Ziele eher zu einer weiteren Verschleierung der Probleme als zu deren Lösung.
Zeit, Geld oder Beachtung fehlen. Wenn zur Beseitigung von unklaren Situationen nicht die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wird die Unklarheit als unüberwindbar erscheinen. Weil man eine Lösung schon einmal vergeblich angestrebt hat, wächst der Glaube, damit leben zu müssen.
Paradoxien und Widersprüche treten zutage, die nicht einfach durch einen Aktionsplan, auch wenn dieser noch so gut gemeint ist, aufgehoben werden können.
Undeutliche Rollen und unklare Verantwortlichkeiten. Zum Teil liegen schon in den Rollenerwartungen, die an jemanden gestellt werden, Widersprüche. Die daraus entstehenden Unklarheiten werden noch gesteigert, wenn die Verantwortlichkeiten nicht klar geregelt sind. Dahinter kann durchaus ein Machtkalkül des Vorgesetzten stecken, nach dem Motto „Teile und herrsche“, oder ein darwinistisches Selektionsprinzip, „Mal sehen, wer der Stärkere ist und sich durchsetzt“.
Erfolgsmaße fehlen. Dort, wo an Menschen Erwartungen gestellt werden, ist es unerlässlich, Orientierungen dafür anzubieten, wann diese Erwartungen erfüllt sind und wann nicht. Ansonsten bleibt es jedem überlassen, seinen Erfolg selbst zu deuten, was nicht im Sinne eines gemeinsamen Handelns sein kann.
Unzureichende Verständigung von Ursache und Wirkung. Mehr als zu erwarten, werden in Auseinandersetzungen Ursachen und Wirkung nicht geklärt oder gar miteinander vertauscht. Wie bei einer unpräzisen Problemformulierung verlieren dadurch Lösungsversuche von vornherein ihre Basis. Solche Verwechselungen sind häufig mit dem beliebten Spiel verbunden, zunächst einmal und vordringlich nach dem Schuldigen zu suchen.
Zeitlichkeit
(Wie wird mit Wandel, Chancen, dem Zeithorizont und dem Timing umgegangen?)
Politisches Handeln, auch mikropolitisches, wird grundsätzlich von dem Aspekt „Zeit“ beeinflusst. Es ist sowohl zeitgebunden wie zeitbindend.
Zeitbindend insofern, als politisches Handeln und damit auch das Bemühen um Einfluss in einem sozialen Kontext stattfindet und Prozesse der Meinungsbildung und Entscheidungsfindung erfordert, die alle Zeit kosten. Das trifft sicherlich weniger auf den Moment zu, an dem die Entscheidung gefällt wird, als vielmehr auf den vorausgehenden Willensbildungsprozess. Willensbildungsprozesse wiederum haben eine inhaltliche Dimension, die jeder Einzelne bei sich selbst zu führen hat und die jeweils dem Abwägen des Für und Wider und dem Ersinnen von Alternativen dient. Sie haben aber auch eine Verfahrensdimension, die den Prozess bestimmt, der zu Mehrheiten führen soll, die eine Entscheidung erst unter demokratischen Regeln ermöglicht.
Zeitgebunden ist politisches Handeln insofern, als sein Erfolg einerseits davon abhängt, ob es aktuell in die Zeit passt, andererseits aber auch, welchen Zeithorizont es umfasst. Die Einpassung in die Zeit umfasst auch den exakten Termin, wann man in einer Organisation ein Thema aufgreift oder auf eine Entscheidung drängt. Der Zeithorizont berührt die Frage, ob man eine Regelung anstrebt, die für alle Ewigkeit zu gelten scheint, oder eine, die für einen bestimmten Einzelfall für eine kurze Zeit als Übergangslösung gefunden werden soll. Insofern bietet sich eine Auseinanderfolge in folgender Struktur an:
- Politisches Handeln als Zeitfresser (und Zeitaufwand)
- Politisches Handeln und Timing
- Politisches Handeln zwischen akutem Ausweg und Dauerlösung
Dimensionen der Persönlichkeit
Die Leseprobe beschränkt sich in diesem Kapitel zunächst auf die Darstellung des bildlichen Gesamtkonzeptes des Autors zur Entfaltung der Dimensionen der Persönlichkeit, die dann im Buch selbst einzeln aufgearbeitet werden.
Ein zentraler Aspekt in Zusammenhang mit dem Faktor Persönlichkeit und deren Beitrag auf den Prozess der Einflussnahme kann man mit dem Begriff der „starken“ Persönlichkeit erfassen. Die Auseinandersetzung mit diesem wichtigen Faktor soll durch die folgende Leseprobe angedeutet werden.
Die starke, weil akzeptierte Persönlichkeit
Bei der Suche nach den verborgenen Quellen für den Einfluss von Menschen auf Menschen, haben mir meine praktischen Erfahrungen weiter geholfen, die ich bei meiner mehr als drei Jahrzehnte dauernden Tätigkeit als Leiter von Führungsseminaren machen konnte. Ob es sich um Themen wie Mitarbeitergespräche, der Umgang mit Konflikten oder um den Führungsstil generell handelte, wanderte der Fokus der Betrachtung immer stärker auf die Analyse und Entwicklung der Führungspersönlichkeit. Die Teilnehmer solcher Führungsseminare, die meist über eine hochqualifizierte Ausbildung als Ingenieure, Naturwissenschaftler oder Ökonomen verfügten, waren sich meistens darin einig, dass bei den Führungskräften – ähnlich wie beim Lehrer in der Schule – die Akzeptanz die wohl größte Rolle spielt. Nun, eine solche Auffassung kann möglicherweise als selbstverständlich abgetan werden. Es erscheint wohl nicht als besonders aussagekräftig, wenn man feststellt, dass die Akzeptanz eine Anerkennung fördert, wie sicherlich auch umgekehrt. Erst, wenn es gelingt, die Quellen der Akzeptanz näher zu bestimmen, kommt man einer respektablen Antwort näher. Hier ist es in erster Linie die Vorbildfunktion bei der Erfüllung der Anforderungen, die an einen selbst bei einer qualifizierten Arbeit gestellt werden. Wenn von jemandem gefordert wird, fachlich und methodisch fundiert zu arbeiten, darf der Vorgesetzte sich nicht nachsagen lassen, selbst nicht fachlich und methodisch qualifiziert zu arbeiten. Das bedeutet allerdings nicht, dass er es auf demselben Teilgebiet sein muss, den ein Mitarbeiter abdeckt. Die Führungsaufgabe besteht vielmehr in der Fähigkeit auf einer „veredelten“ Stufe der Fach- und Methodenkompetenz wirksam zu sein. Dies bedeutet in Algorithmen, d.h. in Lösungsstrategien zu denken und zu handeln. Man könnte dies mit der Alltagsformulierung abdecken „schnell im Kopf zu sein“. Die Vorbildfunktion gilt auch für die Anforderung, aktiv und handelnd die übertragenen Aufgaben zu erledigen und dies in den damit verknüpften sozialen Bezügen. Zusammengefasst bedeutet dies, dass die Führungskraft ihre Akzeptanz zu einem großen Teil aus der eigenen Beziehungsfähigkeit, der eigenen Handlungsfähigkeit und der konzeptionellen Fähigkeit bezieht. Allerdings muss dies von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkannt und in Akzeptanz überführt werden. Man darf sogar behaupten: Wer als Führungskraft nicht akzeptiert wird, kann seine Führungsaufgabe nicht zufriedenstellend erfüllen (sowohl für die Führungskraft selbst als auch für die zu Führenden). Wer als Führungskraft sich nur durchsetzen kann, wenn er auf sein hierarchisch höher angesiedeltes Kästchen im Organigramm verweisen muss, hat als Führungskraft schon verloren. Wer als Führungskraft nicht darauf vertrauen kann, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das vereinbart auch dann tun, wenn er ihnen den Rücken kehrt, wird sich, um seiner eigenen Wertschätzung wegen ein Spitzelsystem aufbauen müssen, damit „seine Leute“ das tun, was sie seiner Meinung nach tun sollen. Dazu reicht allerdings die Vorbildfunktion nicht ganz. Erinnern wir uns an unsere eigenen Erfahrungen mit den guten und weniger guten Lehrern, die wir alle im Laufe unserer Bildungskarriere gemacht haben. Es gibt Personen, die vermitteln eine eigene Aura, die jenseits der funktionalen Rolle spürbar wird.
Erfolgsformel einer Führungskraft
Wer, wie der Autor, sein gesamtes Berufsleben mit der Vermittlung von Inhalten, ob als Hochschullehrer oder als Managementtrainer, verbracht hat, weiß um die didaktische Wirksamkeit von Formeln. Obwohl sie dem Postulat zu widersprechen scheinen, dass Sozialwissenschaften im Allgemeinen und Erwachsenenbildung im Besonderen keine Rezeptologie betreiben sollten, bleiben sie aber im Gedächtnis der Seminarteilnehmer haften und erzielen eine durchaus didaktisch gewollte dauerhafte Erinnerungs- und Auseinandersetzungsfunktion. Eine solche von mir im Rahmen vor allem von Führungskräfteseminaren entwickelte Formel lautet:
F = (f) A(BxHxK)
Zur Erläuterung:
F ist das Kürzel für den Führungserfolg
f bedeutet Funktion
A die Akzeptanz
B die Beziehungsfähigkeit
H die Handlungsfähigkeit
K die konzeptionelle Fähigkeit
Zunächst einmal springt bei dieser Formel die weitgehende Übereinstimmung der Faktoren mit den Grundkompetenzen des Modells KODE® ins Auge. Bei dreien innerhalb der Klammer ist die Deckungsgleichheit schnell zu erkennen. B entspricht weitgehend der sozialkommunikativen Kompetenz, H der Aktivitäts- und Handlungskompetenz und K der Methodenkompetenz als eine qualitativ hervorgehobene Form der Fachkompetenz. Das A vor der Klammer verdeutlicht schon von der Position her seine Besonderheit. Man kann es zunächst naheliegend mit dem P, also der personalen Kompetenz nach KODE® austauschen, allerdings auf eine ausdifferenzierende Art und Weise, die sich alleine schon durch folgendes Phänomen abzeichnet. Während die Methodenkompetenz in der Auseinandersetzung mit Sachaufgaben, die sozialkommunikative durch die Interaktion mit anderen Menschen und die Handlungskompetenz durch das bloße Tun äußerlich erkennbar wird, ist dies bei der personalen Kompetenz nicht in gleichem Maße der Fall. Die dieser Kompetenz zugrundeliegenden Motive und Orientierungen sind möglicherweise die Quellen für die anderen drei Kompetenzen und zudem sind sie nicht unmittelbar erkennbar, sondern lediglich erschließbar. Meinem Empfinden nach vermittelt der Begriff der Quelle ein zutreffendes Bild, vor allem das einer unterirdischen Quelle, die das weitere Fließen irgendwie speist. Gerade das Geheimnisvolle, das darin liegt, mag ein Auslöser für weitere Anstrengungen sein, dieses Geheimnis lüften zu wollen. Einer solchen Verlockung kann sich der Autor nicht entziehen und sich zumindest ein kleines Stück voran wagen.
Ein erster Schritt mag darin liegen, eine erste Begriffsammlung zu kreieren, die wir spontan mit dem A, d.h. der Akzeptanz verbinden können oder die auf die Frage kommen: Welche Voraussetzungen muss ihrer Meinung nach eine Person finden, um sie als starke Persönlichkeit zu anzuerkennen. Als Zielgruppe eines solchen Brainstorming-Verfahrens bewährt sich meinen Erfahrungen nach, wie bei Themen um Führung im Allgemeinen, der Personenkreis, der Führung in doppelter Hinsicht erfährt, und zwar einmal als Führungskräfte selbst zum anderen von ihren Chefinnen und Chefs Geführte.
Trägt man die, die über eine Vielzahl von Führungsseminaren gesammelten Schlagwort zusammen, die so stehen folgende Äußerungen eindeutig oben. Eine solche Person muss
- Charisma haben
- Ausstrahlung haben
- auftreten können
- authentisch sein
- eine Aura vermitteln
- glaubwürdig sein
- andere Menschen mitreißen können
- präsent sein
- Vorbild sein
[1] Schäffner 2012 S. 91ff
[2] Gabler Wirtschaftslexikon, URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/organisation.html
[3] Dazu gehört Chester Barnard obwohl (oder vielleicht gerade weil) er keine Wissenschaftler sondern Vizepräsident eines sehr großen Unternehmens in den USA war. Ausgeführt in seinem schon 1938 erschienenen Buch „The Functions of the Executive“
[4] Neuberger 1995 S. 22f . Neuberger nennt außerdem noch die Akteursperspektive als achtes und sogar erstes Merkmal. Diesem Merkmal sollte meines Erachtens eine besondere, nämlich übergeordnete Bedeutung zukommen. Die anderen hier aufgezählten sieben Merkmale sind als differenzierende Aspekte zu sehen, unter denen das Handeln, das Mikropolitik zentral ausmacht, stattfindet. Insofern stellen sie die Struktur für die nachfolgenden Ausführungen zu den Strategien und Mitteln der Einflussnahme (im Sinne der von mir veränderten Fragestellungen) dar.
[5] Quelle; Oswald Neuberger Mikropolitik 1995 S. 91