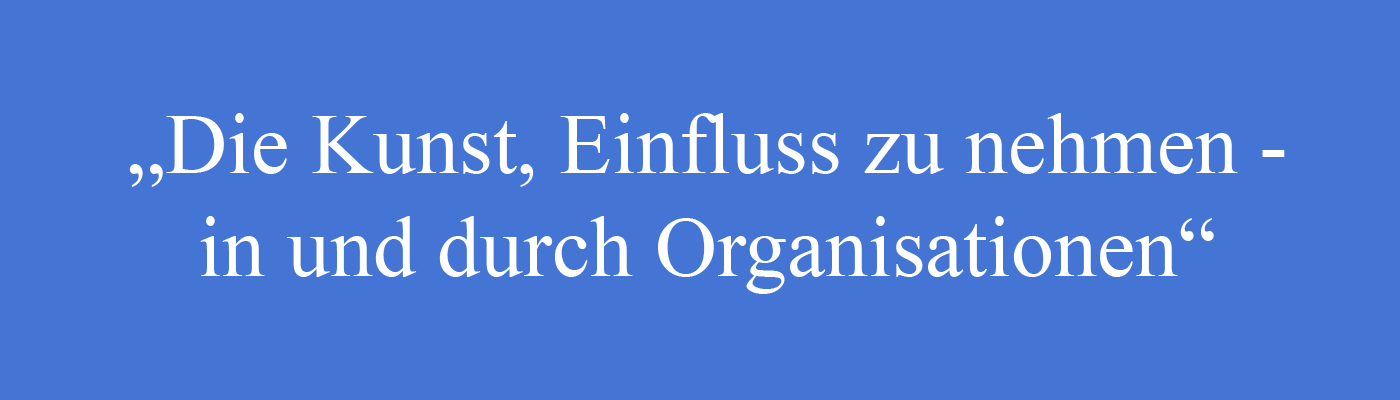Die Bedeutung des Faktors Persönlichkeit
Lothar Schäffner:
Die Kunst, Einfluss zu verlieren. (am Beispiel von Martin Schulz)
Ziel dieses Blog ist, wie schon dargestellt, die Diskussion um die Kunst der Einflussnahme, wie ich sie durch mein Buch angestoßen habe, fortzuführen. Eine Möglichkeit besteht darin, aktuelle Ereignisse aufzugreifen, um sie mit Hilfe der in dem Buch dargestellten Mechanismen und Strategien zu analysieren und wenn möglich Handlungskonsequenzen abzuleiten. Wenigstens ersteres soll in diesem Beitrag versucht werden. Konkret geht es um das Scheitern von Martin Schulz sowohl als Kanzlerkandidat als auch als Vorsitzender der SPD. Es gibt sicherlich eine Fülle von Gründen oder sogar ein gesamtes komplexes System von Faktoren, die als Ursache skizziert werden können. Dazu gehören u.a. die besondere Situation der Regierungsbildung und die strukturellen und auch persönlichen Voraussetzungen in der deutschen Sozialdemokratie. Ich fokussiere jedoch auf die Persönlichkeit des Kandidaten Martin Schulz, oder wenigstens auf das, was er über sich in der Öffentlichkeit und damit auch mir subjektiv vermittelte. Damit ist ein wesentlicher Faktor angesprochen, von dem es abhängt, ob ein Akteur wirkt oder nicht.
Martin Schulz hat in diesem Sinne keine Wirkung erzielt, ein Mangel, der im Kampf um Wählerstimmen sich selbstverständlich verheerend auswirkt. Er ist der eigentliche Verlierer des politischen Geschehens um die Regierungsbildung 2017 und 2018.
Während man Christian Lindner es eher gegönnt hätte, die Rolle eines Gescheiterten einzunehmen, weil eben Hochmut vor dem Fall kommt, wird Martin Schulz letztendlich zu einem tragischen Helden, mit dem man eigentlich Mitleid haben müsste. Nochmals zur Erinnerung: was ist passiert? Unter welchen Rahmenbedingungen hat Schulz seine Ämter als Kandidat und dann als Vorsitzender angetreten?
Martin Schulz, dem man weit weg in Brüssel, also dort, wo man gerne die Politiker hinschiebt, die hierzulande ausgedient haben, wie Günther Oettinger oder David McAllister, einiges zugetraut hat, soll plötzlich den umgekehrte Weg gehen. Er soll zurück in die Heimat und was noch belastender ist, die Erwartungen, die zu Hause an ihn gerichtet werden, sind immens. Er wird zum Heilsbringer erkoren und mit 100% zum Vorsitzenden der traditionsreichen SPD gewählt, ein Ergebnis, das es noch nie gegeben hatte, auch nicht zur Zeiten eines charismatischen Willy Brandt. Die Mischung aus Erstaunen und Überwältigt sein, die damals aus der Gestik und Mimik des Martin Schulz sprach, ist für mich heute noch ein beredtes Bild, das durch den euphorischen Beifall der Sozialdemokraten erst den richtigen Rahmen erhielt.
Jemanden gefunden zu haben, der sich weitgehend außerhalb des Gerangels innerhalb der heimischen Parteienlandschaft bewegt hatte, schien den Ausweg aus einer personellen Krise zu weisen, in der das Personalkarussell der SPD geraten ist. Diese Krise war nicht dadurch entstanden, dass es keine geeignete Bewerber oder Bewerberinnen gab, sondern, dass sich zu viele davon gegenseitig belauerten. In einer Organisation gut bekannt zu sein, bedeutet immer noch nicht, dass einem dies zum Vorteil gereicht. Dies trifft selbst dann zu, wenn das persönliche Image insgesamt positiv ist. Je mehr man über den anderen weiß, desto größer ist auch die Chance, dass man auch dessen Schwächen kennt. In weltanschaulich bzw. politisch orientierten Organisationen gilt dies auch für die differenzierte Wahrnehmung von inhaltlichen Positionen. Dies trifft vor allem für Programm-Parteien zu, die wir dem linken Spektrum zuordnen. So gewinnt innerhalb der Sozialdemokratie die Auseinandersetzung zwischen den Flügeln häufig mehr an Bedeutung als der mit dem eigentlichen politischen Gegner der anderen Parteien. In der Partei „Die Linke“ wird dieses Phänomen nicht weniger ausgeprägt sein.
Da tun sich konservative Parteien oder gar solche, die mehr dem Machterhalt dienen oder gar zum Kanzler- bzw. Kanzlerinnen-Wahlverein werden, leichter. Der Pragmatismus des Machterhalts überwindet einige inhaltliche Gräben. So mag es für manchen sozialdemokratischen Politiker, der von dem linken Flügel seiner Partei eher mit Misstrauen beäugt wird, nahe liegen, sich für das eine oder andere Vorhaben mit Kolleginnen und Kollegen aus der CDU zu verbünden. Statt sich mit Genossinnen oder Genossen herumzuschlagen, die einen schon grundsätzlich in ein anderes Lager ausgegrenzt haben, mag es sinnvoller sein, eine konkrete Fragestellung mit pragmatisch ausgerichteten Akteuren anzugehen, auch wenn sie einer anderen Partei angehören. Allein diese Tatsache mag schon für die Bildung von Koalitionen sprechen, auch für große.
Wie auch häufig bei der Nachfolge von Unternehmensleitungen, sucht man einen möglichen Konflikt zwischen internen Bewerbern dadurch zu vermeiden, dass man schlicht und einfach einen oder eine von außen holt. Und zwar jemanden, von dem man insgesamt einen positiven Eindruck hat, aber noch nicht genügend weiß, um ihn wegen der einen oder anderen Eigenschaft oder Meinung ablehnen zu können.
Insofern ist die Begeisterung für Martin Schulz bei seiner Wahl wohl zu einem großen Teil Ausdruck einer Erleichterung, einen Ausweg gefunden zu haben. Und 100% Zustimmung, eine Quote, die ansonsten nur in einem totalitären Staat vorkommen, war – wie vielen schon gleich bewusst wurde – eine Bürde, unter der man eigentlich nur zusammenbrechen konnte.
Vielleicht wäre es nicht dazu gekommen, wenn Schulz das auf ihn gerichtete Vertrauen strategisch kalkuliert genutzt hätte. Konkret heißt dies, dass er anfangs die Chance gehabt hätte, dieses Vertrauen in Macht umzusetzen. Gerhard Schröder hätte dies gekonnt und hat es auch teilweise unter Beweis gestellt. Nun, Martin Schulz ist eben kein „Basta-Typ“. Selbst wenn ihm geraten worden wäre, so in seiner eigenen Partei und auch in der Öffentlichkeit aufzutreten und selbst, wenn er versucht hätte, dies auch so zu tun, hätte dies nicht funktioniert. Ganz einfach, weil man es ihm nicht abgenommen hätte. Und der Grund hierfür: Es hätte nicht zu seiner Persönlichkeit gepasst. Schulz ist eher ein „Parlierer“ als ein Macher. Er ist ein Verhandler der zwischen unterschiedlichen Interessen vermitteln kann und das auch in mehreren Sprachen. Als Vorsitzender der sicherlich schwierigen sozialdemokratischen Partei, dann als Kanzlerkandidat und schließlich als Juniorpartner einer zu schmiedenden Regierung wurden von ihm andere Fähigkeiten erwartet – oder er meinte, diese würden von ihm erwartet. Er fühlte sich vor allem in der Öffentlichkeit in die Rolle des Machers versetzt und wollte diese nun auch sichtbar ausfüllen. Gerade dieser Übergang ist ihm misslungen. In die Begrifflichkeit des symbolischen Interaktionismus übersetzt ist ihm die Transformation von einem role taking zu einem role making nicht geglückt. Role taking bedeutet im Sinne einer funktionalistischen Rollentheorie die Übernahme bestimmter Rollenvorschriften, die relativ fest geschrieben sind, role making ist die Ausgestaltung d.h. deren Interpretation je nach den individuellen Vorstellungen und Möglichkeiten. Gelingt der Prozess des role making, wird der Akteur mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als authentisch wahrgenommen, als wenn ihm dies nicht gelingt. [1] Martin Schulz ist dies nicht geglückt. Man kann es auch anders formulieren: bei dem Versuch, dem Rollenbild zu entsprechen, das er für sich selbst im Kopf hatte, bzw. von dem er gemeint hat, ihm entsprechen zu müssen, ist er gescheitert. Mannhaft und ganz entschieden, die Fäden schnell und fest in der Hand haltend, wie z.B. die Festlegung am Wahlabend 24. September 2017, die Koalition mit der CDU/CSU wäre damit beendet oder die ablehnende Antwort auf die (hinter)listige Frage eines Journalisten, ob er in eine Regierung Merkel eintreten würde, wollte er „rüber kommen“. Dass er später von diesen Äußerungen abrücken musste, brachte ihm eine Fülle von Häme ein, die schließlich auch sein vorläufiges Ende in der nationalen Politik einleitete. Weder mit Häme noch mit Parteinahme ist schließlich die Vermutung anzustellen, dass Angela Merkel, dies nicht passiert wäre. In ihrer Rauten gestützten „Behäbigkeit“ bleibt sie trotz der wachsenden Kritik an diesem Verhalten nun schon über lange Jahre authentisch.
Was war nun aber letztendlich der entscheidende Akt, der Schulz zum Rückzug zwang? Was war der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? Es war die Entscheidung, das Amt des Außenministers in einem neuen Kabinett Merkel bekleiden zu wollen, oder präziser formuliert: Es war die Ankündigung, dieses anzutreten. Für die Journalisten war dies ein gefundenes Fressen, das zu einer kollektiven geradezu stereotype Interpretation führte. Vorneweg Hans-Ulrich Jörgens der Starjournalist, der eigentlich vor lauter Talk Show Auftritten nicht mehr zum Schreiben kommt oder sich dann so wenig differenzierte Gedanken macht, dass er sich eben auf pauschale Erklärungen beschränkt. Dahinter ist auch ein Mangel an Ambiguitätstoleranz zu vermuten, den man gerne den Deutschen vorwirft, und dies nicht zu Unrecht. Und dieser Mangel verleitet zur Bildung von schlichten Formeln, und eine davon zielt darauf ab, das politische Handeln. durch den grassierenden Virus der Egomanie bedroht zu sehen. Dies war der Grundtenor, der das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen kommentierend begleitete.
Nun, abgesehen davon, dass kaum einer in die Politik gehen würde, wenn er nicht einen Überschuss an solchen Motiven hätte, kann man gerade auf Schulz bezogen, dies nicht so stehen lassen. Schulz hatte aufgrund seiner Unerfahrenheit in dem Berliner politischen Milieu nicht wahrgenommen, dass er trotz Heiligenscheins der 100% plötzlich im wahrsten Sinn des Wortes hinten runter fallen könnte. Das Drama oder besser die Tragödie um Schulz hat sich abgespielt in der kleinen aber beliebten Anekdote, die gerne in Zusammenhang mit einer kooperativen Kultur erzählt wird. Das Huhn und das Schwein kamen eines Tages, als sie sich Gedanken um ihre wirtschaftliche Zukunft gemacht haben, auf die Idee, eine Kooperative zu bilden, die für das Essen auf dem Frühstückstisch sorgt. Beide waren ob ihrer Idee begeistert. Das Huhn behielt diese Gefühlslage, nur das Schwein erschrak, als es ihm bewusst wurde, was das für ihn bedeutete. Nun, man braucht sich angesichts der Tatsache, dass diese Metapher auch für menschliches Tun herhalten soll, sich nicht auf das Schwein als Tier beschränken, man kann auch das Rind wählen. Wir sind ja nicht Böhmermann, der die Auffassung vertritt, der Mangel an geschliffenem intellektuellem Werkzeug wäre gleichbedeutend mit Provokation. Wer nicht in der Lage ist, gesellschaftliche Mängel exakt zu sezieren und gleich mit dem Hammer zuschlägt, braucht sich nicht zu wundern, wenn er nachher ausschließlich damit beschäftigt ist, die ganze Sauerei wieder wegzuwischen.
Aber zurück zu Schulz. In seiner etwas naiven Vorstellung, alles zu tun, um nicht den Eindruck zu erwecken, er hätte seine Partei „gelinkt“, also etwas, was man ihm angesichts der enormen Anstrengungen der Legitimation später hätte übel nehmen nicht nur können oder auch müssen, hat er für seine Offenheit schlicht und einfach den falschen Zeitpunkt erwischt. Und dies gerade in dem Bemühen, diesen nicht zu verpassen. Und dies ist geradezu tragisch. Ihm ist plötzlich deutlich geworden, dass er Gefahr läuft, nach den Verhandlungen und der Abstimmung darüber, plötzlich mit leeren Händen dazustehen, sich gewissermaßen zu opfern.
Da hilft auch nicht das geflügelte Wort, dass das Amt des Vorsitzenden der Deutschen Sozialdemokratie das zweitschönste Amt nach dem des Papstes sei. Wer in dieser Funktion nicht mehr den erforderlichen Rückhalt in der Partei hat, ist anders als der Papst, dessen Kollegium an Kardinalen nur in großen Abständen tagt und der zudem auf Lebenszeit gewählt ist, auf verlorenem Posten. Man kann den gesamten Prozess auch mit einer Metapher andeuten, der gerne in der Sprache der Fußballer verwendet wird. Schulz ist von der Operettenliga in die des brutalen Profigeschäfts der zweiten Bundeliga gelandet. Dort, wo man noch nicht den gepflegten Fußball der ersten Liga spielt, sondern den etwas härten Umgang miteinander pflegt, der nun mal notwendig ist, wenn man aufsteigen will. Also der Wechsel von der Brüsseler und Straßburger Salonpolitik in die raue Berliner Schnoddrigkeit, der es schon gar nicht an Ellenbogen-Gerangel fehlt, ist nicht geglückt.
Gerade in einer Zeit, in der die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf Personen fokussiert, erfordert dies von den an der Spitze und zur Wahl stehenden Politiker bestimmte persönliche Fähigkeiten. vor allem von dem Herausforderer. Die Aufmerksamkeit richtete sich nämlich weniger auf Merkel, da ihr Profil in der Bevölkerung trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Unschärfe fast schon zu einem positiven Markenzeichen eines Pragmatismus geworden ist, sondern auf ihren Herausforderer. Diesem war dies selbstverständlich bewusst und er versuchte Eindruck zu machen. Aber welchen wollte er denn machen, welchem Anspruch wollte er genügen und vor allem auch, welchen konnte er von seiner persönlichen Ausstrahlung her ausfüllen? Gab es ein Vorbild, gab es einen Anforderungskatalog, haben ihm forsche Berater eine falsche Blaupause geliefert oder hat er sich selbst eine aus seinen inzwischen antiquarischen Büchern ausgesucht? Wenn, dann hat er eine gewählt, die ihm nicht stand. Das heißt nicht, dass er bei der Besetzungsprobe, die es bei einer Theaterinszenierung gibt, die falsche Rolle erhalten hat, das heißt nicht, dass er eine Fehlbesetzung war. Er konnte oder durfte die Rolle nicht so ausgestalten, wie es seiner Persönlichkeit entsprach. Und wenn er es selbst nicht so genau wusste, hätte er jemanden gebraucht, der ihn entsprechend gecoacht hätte. Was blieb ist ein Bild der Orientierungslosigkeit die weit über eine Sachfrage hinausreichte und die gesamte Persönlichkeit von Schulz umfasste und ihn sogar zu einer gerne benutzten Karikatur machte. Nicht jeder brachte dies allerdings so gekonnt ins Bild wie Klaus Stuttmann:

www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturen/6578
Fassen wir die Interpretation der Ereignisse um Martin Schulz nochmals auf zwei zentrale Dimensionen der Persönlichkeit vor allem in ihrer Wirkung in der Öffentlichkeit zusammen. Es sind Charisma und Authentizität.
Der Begriff Charisma trägt eine doppelte Bedeutung in sich, wie in dem zugrundeliegenden Buch ausgeführt wird. „Zum einen zielt der Begriff auf die Art und Weise des Handelns selbst zum anderen auf die Legitimationsgrundlage des Handelns. Max Weber beschreibt charismatische Führung neben der bürokratisch/rationalen und der traditionell/patrimonialen als eine Herrschaftsform. Charisma beruht dabei auf einer besonderen Begabung oder sogar der Gabe eines Menschen, Ausstrahlung auf andere Menschen auszuüben.
Diese wird durch die Beziehung eines Charisma-Trägers und den Charisma-Gläubigen bzw. -Anhängern gebildet. Es ist eine Herrschaftsbeziehung, die, anders als z.B. die bürokratische, vor allem emotional begründet ist. Sie kann dort entstehen wo die Charisma-Gläubigen in einer Person einen „Heilsbringer“ entdecken, der sie als starker Mann aus einer Krise herauszuführen verspricht. Während die Analyse der Situationen, die den Nährboden für eine charismatische Herrschaftsbeziehung darstellen, auf einer historischen, politologischen und soziologischen Ebene stattfinden muss, ist die Auseinandersetzung mit der Person, die den charismatischen Führer abgibt, eher eine psychologische und fragt nach den Voraussetzungen, die eine solche mitbringen muss. In einem zweiten Schritt ist es interessant, nachzuspüren, wem man eine solche charismatische Wirkung konkret zuschreiben kann.
Basis für die Wirkung von Charisma ist das „Funkeln in den Augen“, das verrät, dass man von der Sache, die man vertritt, selbst voll überzeugt ist. Der Schlüssel auf der Sachebene liegt darin, dass der Nutzen des Tuns im Sinne der eigenen Überzeugung für die anderen ebenfalls groß ist. Auf der Beziehungsebene ist ein Merkmal, dass man dem anderen ebenfalls Erfolg lässt und hinsichtlich des Umgangs mit Mitstreitern, dass man die Führung lebt, auch im Sinne von Vorleben.“ (S.264) Damit ist zugleich die Schnittmenge angedeutet, die eigentliche Bedeutung dieser zentralen Persönlichkeit-Dimensionen ausmachen, und zwar die Authentizität.
Authentizität als Kriterium zur Kennzeichnung einer Persönlichkeit folgt einer anderen Bewertungslogik als Charisma. Während man Charisma als ein besonderes Merkmal bzw. als eine Gabe dann als hervorzuhebendes Merkmal positiv besetzt, aber es nicht als persönlichen Makel empfindet, wenn man nicht darüber verfügt, ist dies bei der Authentizität anders. Es ist eben nicht egal, ob jemand authentisch ist oder nicht, vor allem wenn der Aspekt der Ehrlichkeit in den Vordergrund rückt. Ist jemand nicht authentisch, wird dies als persönliches Defizit empfunden. Und wenn jemand kontinuierlich als nicht authentisch empfunden wird, wird dies zu einer Kritik, die die gesamte Person umfasst
Authentizität zu erklären, erweist sich z.T. schwieriger als die Beschreibung, was Authentizität nicht ist. Ein Zeichen von nicht authentischem Verhalten bzw. Meinen, das hinter diesem Verhalten verborgen liegt, ist die Nichtübereinstimmung von kommunikativen Signalen, bei der Übermittlung einer Botschaft.
Ein empfundener Mangel an Authentizität wird besonders negativ empfunden, da die Glaubwürdigkeit von Politikern in der allgemeinen Wahrnehmung nicht so groß ist. Wahrscheinlich auch als stereotype Verarbeitung der eigenen Machtlosigkeit.
Gerade dieser Mangel an Glaubwürdigkeit oder präziser formuliert, die Angst, als unglaubwürdig zu erscheinen war es, die letztendlich zum Scheitern von Martin Schulz geführt hat und nicht ein Defizit an charismatischer Ausstrahlung. Da hätte er wohl kaum schlechter abgeschnitten als seine Gegnerin Angela Merkel. Schulz bemühte sich schon frühzeitig , seine Absicht, das Außenministerium zu besetzen, offen kundzutun, um eben diesem potenziellen Vorwurf zu begegnen, geriet damit aber in Widerspruch zu dem taktischen Spiel, das alle Parteien als Lüge vor sich hertragen. „Wir verhandeln zuerst die Sachfragen und erst danach werden personelle Entscheidungen getroffen“. Der Transport eines von ihm nicht auszufüllenden Bild des Managers von politischen Prozessen (taff und entschieden) konnte Schulz nicht in Einklang bringen mit dem Wunsch, sein Handeln möglichst transparent erscheinen zu lassen, zumal er sich mit einem schwergewichtigen Gegner aus den eigenen Reihen auseinandersetzen musste. Dieser machte ihn mit einer schlichten, einem Kind zugesprochenen Metapher „der Mann mit den Haaren im Gesicht“ sogar zum Gespött und hat ihn damit seiner ernsthaften Handlungsmöglichkeiten beraubt. Als Karikatur wahrgenommen zu werden mag unter satirischem Blickwinkel die Lösung darstellen, ein Rest an makabrer Authentizität zu bewahren. Dies geht aber mit dem Verlust der Akzeptanz als Politiker einher und markiert mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ende einer politischen Karriere. Möglicherweise wäre Schulz ein so jäher Absturz jedoch erspart geblieben, wenn er das übliche politische Spiel weitergetrieben und sich in irgendeine spätere Erklärung geflüchtet hätte. Im Rahmen der Regierungsbildung hätte er genug Vorbilder gehabe, wie z.B. Seehofer, der sich zufrieden gab, die „Obergrenze“ für Flüchtlinge als Bedingung für eine Regierungsbeteiligung, in „atmenden Deckel“ umzubenennen.
Auch hier hat Klaus Stuttmann einen satirischen Vorschlag unterbreitet:

www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturen/6650
Der Weg von einer Tragödie zur Satire scheint nicht weit zu sein, wenigstens für die außenstehenden Kommentatoren.
[1] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass man die Rolle bewusst spielt und gleichzeitig zu erkennen gibt, dass es tatsächlich nur ein Spiel ist. Dies mag in einzelnen gesellschaftlichen Bereichen funktionieren, nicht aber in der Politik. Die verlorene Wahl Steinbrücks, der immer eine gewisse ironische Distanz ausstrahlte mag ein Beleg für diese These sein