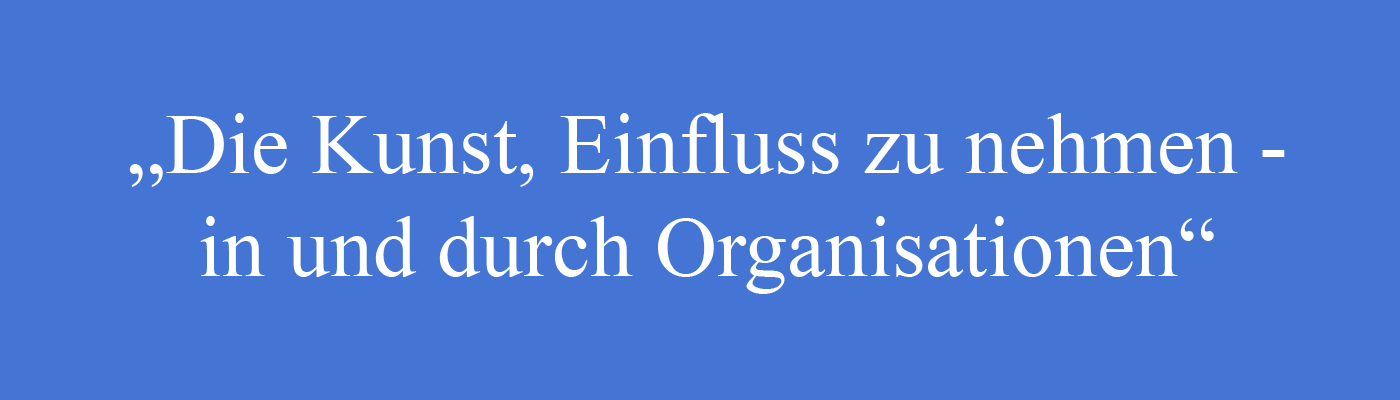Zur Konzeption und zum Anspruch des Buches
Mit diesem Buch wird nicht der Anspruch verknüpft, eine geschlossene Theorie für das Phänomen der Einflussnahme anzubieten. Es nimmt vielmehr Anleihe bei verschiedenen theoretischen Modellen, um die Wirklichkeit bei dem Versuch der Einflussnahme zu erklären, wie ich sie erfahren habe und viele andere mit Sicherheit auf eine vergleichbare Art und Weise. Der mögliche Vorwurf des Eklektizismus trifft mich nicht, solange die unterschiedlichen Ansätze einerseits der Erklärung dienen und sich andererseits nicht widersprechen. Über die analytische Hilfe hinaus, das zu begreifen, was um sie herum passiert, können die Leser können daraus Orientierungen für ihr eigenes Handeln ableiten, wenn sie bestrebt sind, als Akteure ihr eigenes Umfeld mitzugestalten.
Der Gegenstand des Buches ist das Phänomen der Einflussnahme, das wir alle sowohl aus der Perspektive der Agierenden als auch der des Betroffenen allgegenwärtig erfahren, allerdings mit einem ausdrücklichen Fokus auf den Akteur.
Das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis, zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und selbst erlebter Praxis, wird dabei bewusst gesucht und nutzbar gemacht.
Hintergrund sind Modelle aus der Wissenschaft der Politik und der Erwachsenenbildung, mit denen ich mich während meines Studiums der Politikwissenschaft an den Universitäten Tübingen und Kiel und später während meiner Professorentätigkeit am Institut für Berufspädagogik und Erwachsenenbildung an der Universität Hannover auseinandergesetzt habe. Aufgearbeitet werden dabei nicht nur die Inhalte der wissenschaftlichen Reflektion, sondern auch die Erfahrungen mit der Berufstätigkeit in diesen Wissenschaftseinrichtungen. Ebenso wie die, die ich in anderen Berufen und gesellschaftlichen Feldern machen konnte. So vor allem in den Einrichtungen der praktischen Erwachsenenbildung und auch in Unternehmen, in denen ich hauptberuflich tätig war oder von denen ich im Rahmen von Projekten der Personal- und Organisationsentwicklung als Berater herangezogen wurde. Je nach Sichtweise kann man den von mir gewählten Ansatz als den Versuch deuten, eine durch Praxisbeispiele verdeutlichte Theoriebildung zu kreieren oder eine theoretisch reflektierte Erfahrung zu vermitteln. Ob das Ergebnis einen Ratgeber abgibt, müssen die Leser für sich selbst entscheiden. Es hängt davon ab, ob ihnen eine grobe Orientierung für ihr Handeln ausreicht, oder ob sie ein „Hilfe Schritt für Schritt“ nach der Rezeptbeschreibung „man nehme, so man hat…“ brauchen. Auf alle Fälle soll eine solche potenzielle Orientierungshilfe nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Kopf haben.
Auf einer eher methodischen Ebene versuche ich in diesem Buch Faktoren zu beleuchten, die die Kunst ausmachen, in und durch Organisationen Einfluss zu nehmen. Dabei möchte ich es nicht auf einer theoretischen Ebene bewenden lassen, sondern die Erkenntnisse durch persönliche Erfahrungen belegen und zugleich lebendig werden lassen. Wenn mir meine Studentinnen und Studenten während meiner Tätigkeit als Hochschullehrer das Markenzeichen verpasst haben „der Schäffner, weiß wovon er spricht“, habe ich dies als ein in diesem Beruf anzustrebendes Lob verstanden. Wenn die Leser meines Buches ein vergleichbares Fazit ziehen, hat sich für mich die Arbeit an diesem Buch und für die Leser den dafür entrichteten Kaufpreis gelohnt.
Auf einer eher inhaltlichen, in einem gewissen Maße auch moralischen Ebene geht es mir darum, in diesem Buch aufzuzeigen, welches Verhalten in bestimmten Prozessen der Willensbildung in und durch Organisationen funktioniert und warum dies so sein mag. Dabei ist dieses Verhalten, das unter dem ausschließlichen Diktat der eigenen Zielerreichung steht, nicht als beliebig anzusehen. Es geht um ein Agieren, das den Werten einer aufgeklärten Gesellschaft gerecht wird. Gerade dies gilt es in Zeiten zu bewahren, in denen das Lügen und das Täuschen mit dem Begriff postfaktisch fast sterilisiert und damit verharmlost werden.