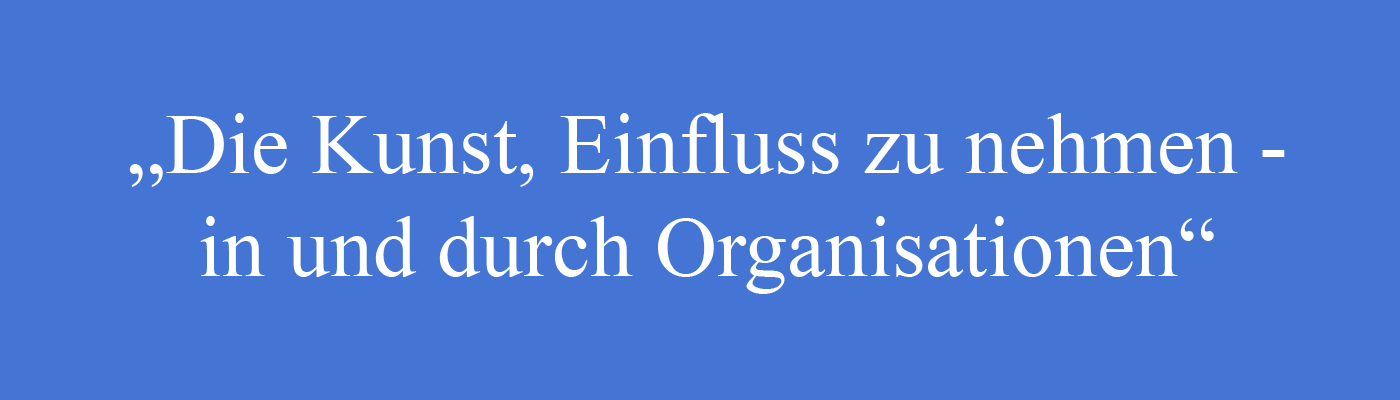Biographischer Bezug
Vorab die schon fast übliche Erklärung zur gewählten Schreibweise. Das Buch ist durchgängig in männlicher Form geschrieben auch wenn Frauen gleichermaßen gemeint sind. Meine Entscheidung dient der Erleichterung des Schreib- und des Leseflusses und ist nicht zuletzt dadurch bestimmt, dass in meinen Ausführungen vermehrt Erfahrungen aus der Leitung von Organisationen eingebracht werden, die in der erfassten Zeit überwiegend von Männern bestimmt war. Dies wird sich in der Zukunft durch die Integration der Frauen in die bisherigen Männerdomänen verändern. Gerade dieser Prozess ist von mir durch die wissenschaftliche Begleitung von Projekten zur Öffnung von ehemals typischen Männerberufen für Frauen und durch die eigene Einstellungspolitik in Unternehmen und in der Universität persönlich befördert worden. Ich bin sicher, dass in nicht zu langer Zeit ein solches Buch aus weiblicher Perspektive geschrieben werden wird, und dies ist gut so.
Wie schon angedeutet, enthält dieses Buch biographische Bezüge vor allem dort, wo es auf eigenen Erfahrungen aufbaut. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der Autor in der Ich-Form als Protagonist auftaucht. Ob als handelnder Held, ist allerdings fraglich. Als Held insofern nicht, als ich die Manier der amerikanischen Sachbuchautoren ablehne, die sich vor allem in der Managementliteratur als die Heilsbringer präsentieren. Sie beschreiben einen Elendszustand, aus dem sie und ihr Team – amerikanische Sachbuchhelden haben immer ihr Team um sich – die Rettung bringen, und die Welt ist fortan wieder ok. Zweifellos tut es mir auch gut, auf eigene Erfolge hinweisen zu können, und dies nicht ohne Stolz. Dennoch, so hoffe ich, merkt man dies nicht allzu sehr, oder wenigstens wirkt es nicht, als sei das ganze Buch nur zu diesem Zwecke geschrieben worden.
Haben wir damit den Heldenstatus einigermaßen relativiert, bleibt der des Handelnden übrig. Durchforstet man aufmerksam Lebensgeschichten, vor allem solche, die als Autobiographien deklariert werden, kann man durchaus feststellen, wer wann und in welchem Maße die oft zitierten Zügel selbst in die Hand nahm und wo er eigentlich nur ein vom Schicksal Geworfener war. In diesem Spannungsverhältnis zwischen Schicksal und gezieltem eigenverantwortlichem Agieren, wird häufig folgender Satz zitiert: Das Leben ist das, was uns passiert, wenn wir auf ein Ziel hinsteuern. Solch eine als Lebensklugheit verkaufte Formel kann man allenthalben in den verschiedensten Magazinen lesen, in denen die Lebensgeschichten von berühmten Persönlichkeiten verkauft werden. Vielleicht sollte man diese Klugheit noch präzisieren, durch eine Ergänzung anreichern und sie komplettieren zu der Alltagsweisheit: Dein Leben ist das, was Du daraus machst, was dir passiert, wenn du auf ein Ziel hinsteuerst. Diese Weisheit spiegelt das Wechselverhältnis wider, das die gegenseitige Abhängigkeit des eigenen Strebens mit der Unberechenbarkeit der von uns unbeeinflussbaren Ereignisse bestimmt.
Ich weiß nicht, wann ich zum ersten Mal versucht habe, gezielt und bewusst Einfluss zu nehmen. Natürlich hat mein Schreien als Baby meine Mutter auf den Plan gerufen. Sie tat dies möglicherweise trotz anderslautenden Tipps aus der Verwandtschaft und dem Bekanntenkreis, die ihr rieten, mich ruhig länger schreien zu lassen, damit ich sie nicht ständig drangsaliere. Nun, dies war in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, in der es noch als Erziehungsprinzip galt, dem kleinen Erdenbürger den Willen zu brechen. Ich dagegen blieb ganz unschuldig. Ich habe mich nicht mit den anderen Säuglingen „beim Fläschchen-Klatsch“ ausgetauscht und gierig den Rat der einen Monat älteren Leidensgenossen aufgesogen, möglichst herzerweichend zu schreien, dann würde garantiert jemand kommen. Auch später als Kleinkind bestand meine Einflussnahme vor allem darin, dass ich etwas noch nicht so gut konnte wie meine beiden älteren Brüder: Schnürsenkel binden, Brot schneiden oder etwas oben aus dem Schrank holen. Zur Beschleunigung des Tagesablaufs in unserer Familie haben sie es dann eben schnell gemacht. Daran, dass ich mich dabei zurückgelehnt und die Dienstleistungen meiner Brüder genossen hätte, kann ich mich keinesfalls erinnern. Im Gegenteil, auch und gerade kleine Kinder haben das Bedürfnis, selbstständig zu sein, und das empörte Zurückweisen fremder Hilfe mit einem „kann ich schon alleine“, ist ein kleiner Ruf nach Freiheit, Gleichheit und in meinem Fall auch tatsächlich Brüderlichkeit.
Als Jüngster, oder soziologisch deklariert: als Letzter in der Geschwisterreihe, steht man zunächst unter dem Diktat der Großen, auch wenn es hilfsbereit daherkommt. Mein ältester Bruder, Bruno, bestimmte in der Rollenteilung zwischen uns dreien, was ästhetisch gelungen und politisch richtig war. Der mittlere von uns Brüdern war der unbesiegbare Sportler, der als jugendlicher Ringer sich lieber hätte umbringen als aufs Kreuz legen lassen und als gleichzeitiger Gewichtheber, es als sportliche Freude empfand, vier Kohlenfüller auf einmal vom Keller in unsere im 5. Stock liegende Behausung zu bringen. Mir blieb letztendlich die Rolle des Pfiffikus, der es verstand die Kräfte seines größeren Bruders gegen irgendwelche Attacken aus dem Kreise der Schulkameraden einzusetzen. Er war wirklich mein großer Bruder und übernahm mir gegenüber fast die Ersatzrolle des Vaters, der kurz bevor ich ein Jahr alt wurde, zum Ende des zweiten Weltkriegs, gefallen ist. Aus dieser Beschützerrolle und alleine der Tatsache heraus, dass er immer für mich da war und auch in meiner Nähe blieb, leitete sich sein großer Einfluss auf mich her.
Besser kann ich mich daran erinnern, wann ich zum ersten Mal Eindruck gemacht habe. Dabei kommt mir sofort Frau Beerhenke in den Sinn, die ich heute noch deutlich vor mir sehe und deren Name mir zudem immer noch so geläufig ist, weil er in meiner schwäbischen Heimat äußerst fremdartig klang. Da hieß man Schäufele, Schuster oder vielleicht auch Schäffner. Sie wohnte in der gleichen Straße und versorgte ihren schon erwachsenen Sohn, der im Kriege verwundet wurde und aus diesem Grunde nur noch leichte Heimarbeit verrichten konnte. Die bestand darin, Stoffknöpfe herzustellen, und meine beiden älteren Brüder trugen diese für ein paar Pfennige aus. Ich hatte ebenfalls zu dieser feinen, sehr zugewandten Dame eine eigene Geschäftsbeziehung. Jedes Mal – oder fast jedes Mal – wenn sie mich auf der Straße spielen sah, kam sie auf mich zu, strahlte mich an und sagte: „Ach, du bist so ein fröhliches und liebes Kind“, und drückte mir zehn oder sogar zwanzig Pfennige in die Hand. Für mich gab es fortan keinen Grund mehr griesgrämig durch die Welt zu gehen. Den Gedanken, es mal mit einem mürrischen Gehabe zu versuchen, habe ich nie gehegt. Ich bin mir zudem sicher, dass dies auch nicht so gut honoriert worden wäre. So habe ich mir meine fröhliche Art bis heute weitgehend oder sagen wir einmal grundsätzlich erhalten. Zwanzig Pfennige habe ich allerdings schon lange nicht mehr zugesteckt bekommen. Und dies liegt wohl nicht nur an der Währungsumstellung.
Wenn ich ansonsten auf die biographisch bedingten Einflüsse zurückblicke, so hatte ich die für die Nachkriegszeit nicht unüblich schwere Jugend. Meine Mutter, meine Brüder und ich standen zunächst vor dem Nichts zumal wir ausgebombt waren und mein Vater nicht mehr aus dem Krieg zurückkam. Wir versuchten aus dieser Notsituation gemeinsam herauszukommen, und dies ging letztlich nur durch aktives Handeln jedes Einzelnen. Damit wurden vor allem wir drei Brüder, jeder auf seinem Gebiet, zu bemerkbaren Akteuren. Agieren blieb für mich mein wesentliches Elixier, mein Leben zu leben. Zunächst einmal, um schlicht und einfach Geld ins Haus zu bringen, aber auch, um in Schule und Beruf voran zu kommen und insgesamt von unserer sozialen Umgebung positiv wahrgenommen zu werden. Meine Brüder gingen in die Lehre und ich durfte auf die höhere Schule. Dies befreite mich jedoch nicht vor der Verpflichtung durch Aushilfsarbeiten in einer Bäckerei, einer Buchbinderei, einer Kleiderfabrik oder schlicht durch das Austragen von Zeitschriften etwas zum Familieneinkommen beizutragen. Trotzdem hatte ich rückblickend immer noch genügend Zeit, regelmäßig den Hund von Nachbarn auszuführen und mit ihm durch die meine Heimatstadt Stuttgart umgebenden Wälder zu streifen.
Wenn es um die nicht ökonomischen Aktivitäten ging, richtete mein ältester Bruder sie auf die Kunst, mein mittlerer Bruder auf den Sport und ich eher auf die Leitung und organisatorische Gestaltung meines Umfeldes. So wurde ich Herausgeber der Schülerzeitung meines Gymnasiums und später Schulsprecher, d.h. in der damaligen Terminologie „Vorsitzender der Schülermitverwaltung“. Und wenn es darum ging, bei irgendwelchen Veranstaltungen meiner Heimatstadt für die Schülerschaft in der Öffentlichkeit eine mehr oder weniger launige Rede zu halten, wurde ich damit beauftragt. Sitzungen und Versammlungen leiten bzw. moderieren und Reden halten, gehörten bald zu meinen Kernkompetenzen und werden bis heute noch nachgefragt. Sollten die Leser der Meinung sein, dass das Schreiben so langsam auch dazugehört, wäre dies schön.
Diese Kompetenzen konnte ich dann auch während meines Studiums und auch später in meinem Beruf oder meinen Berufen einbringen und weiterentwickeln. Und wenn man meine Berufsbiographie als insgesamt erfolgreiche Biographie bewerten mag, waren sie auch Garanten eines solchen Erfolges.
Während meines Studiums konnte ich meine Akteursrolle vor allem außerhalb des regulären Universitätsbetriebes, der für mich Pflicht war, im Theaterbereich, ausleben. Während mein großer Bruder sich der großen Bühne verschrieb und später von Beruf Schauspieler wurde, begnügte ich mich als kleinerer Bruder mit dem Brettl und gründete während meines Studium der Politikwissenschaft, der Germanistik und der Geographie in Tübingen (mit der absichernden Aussicht, wenigstens Gymnasiallehrer werden zu können) ein Studentenkabarett. Nach meinem Wechsel an die Universität Kiel beschränkte ich mich auf einige kabarettistische Soloauftritte und wendete mich nebenamtlich dem Amateurtheater zu, als Textschreiber, Regisseur und z.T. auch als Einmann-Jury. Etwas „höhere Weihen auf der kleinen Bühne“ erhielt ich als Leiter der studentischen Studiobühne und schließlich eines internationalen Amateurtheater-Workshops.
Glücklicherweise konnte ich meine außeruniversitären Aktivitäten mit meinem Studium verbinden und dieses damit zu einem relativ raschen und erfolgreichen Abschluss bringen. Das Glück bestand darin, mit dem Direktor des Instituts für Geschichte und Wissenschaft der Politik einen Professor gefunden zu haben, der mich mit einem Dissertationsthema zum politischen Kabarett als seinen Doktoranden annahm und der mir damit die Grundlage ermöglichte, den schriftlichen Aufwand für eine Staatsexamensarbeit und den für eine Dissertation mit einer einzigen Arbeit zu bewältigen. Erfolgreiches Agieren besteht, so meine Erkenntnis, zu einem wesentlichen Teil darin, Vorgänge miteinander zu verknüpfen, um damit sowohl den inhaltlichen Ertrag und den zeitlichen Aufwand in ein möglichst günstiges Verhältnis zu bringen.
Damit relativ früh, mit gerade mal 26 Jahren mit Promotion und Staatsexamen ausgewiesen, hatte ich mir einen guten Ausgangspunkt für meinen Start in das Berufsleben geschaffen und ich denke auch genutzt. Ein überraschendes Angebot aus der Erwachsenenbildung, das ich eher meinen außeruniversitären Aktivitäten zu verdanken hatte, wies mir – abweichend von der Zukunft an einem Schleswig-Hosteinischen Gymnasium – eine alternative für mich höchst attraktive Berufsperspektive, die ich sofort ergriffen habe. Die Erwachsenenbildung als neu zu konstituierendes Berufsfeld bot mir all die Chancen der Einflussnahme, die ich u.a. im weiteren Verlauf des Buches versuche aufzuarbeiten.
Dies führt zu einer weiteren Erkenntnis, die die Kunst der Einflussnahme ausmacht. Chancen, die sich auftun, sollten auch genutzt werden.